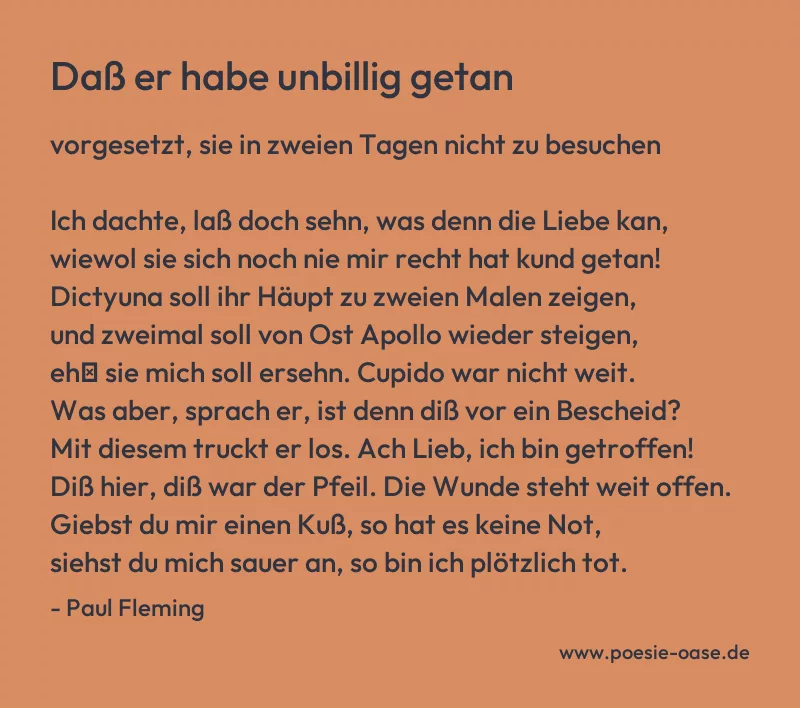Daß er habe unbillig getan
vorgesetzt, sie in zweien Tagen nicht zu besuchen
Ich dachte, laß doch sehn, was denn die Liebe kan,
wiewol sie sich noch nie mir recht hat kund getan!
Dictyuna soll ihr Häupt zu zweien Malen zeigen,
und zweimal soll von Ost Apollo wieder steigen,
eh′ sie mich soll ersehn. Cupido war nicht weit.
Was aber, sprach er, ist denn diß vor ein Bescheid?
Mit diesem truckt er los. Ach Lieb, ich bin getroffen!
Diß hier, diß war der Pfeil. Die Wunde steht weit offen.
Giebst du mir einen Kuß, so hat es keine Not,
siehst du mich sauer an, so bin ich plötzlich tot.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
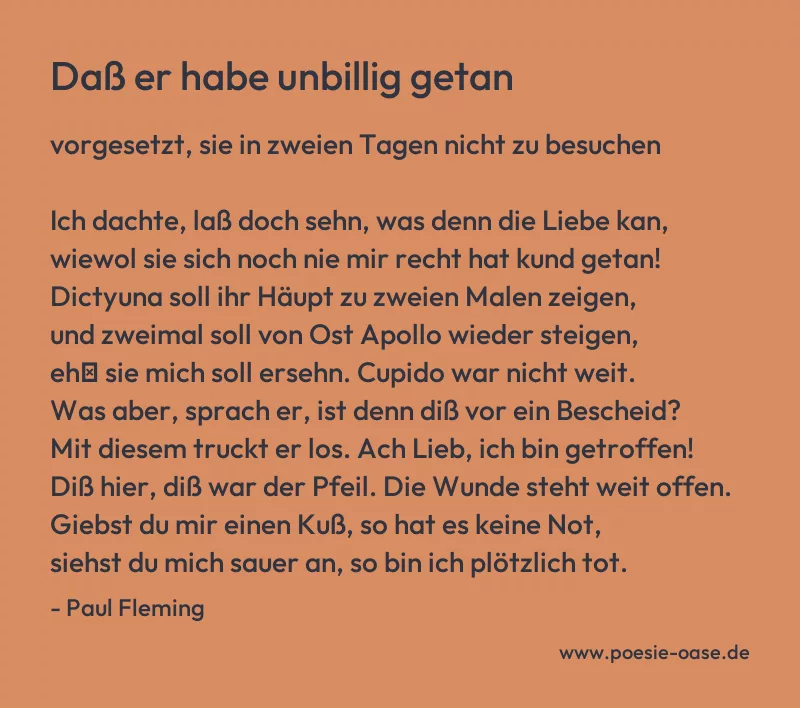
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Daß er habe unbillig getan“ von Paul Fleming ist eine kurze, aber intensive Auseinandersetzung mit der Macht und den Auswirkungen der Liebe. Es handelt sich um eine Reaktion des lyrischen Ichs auf eine vorgesetzte Bedingung, die es daran hindert, die Geliebte innerhalb von zwei Tagen zu besuchen. Diese Einschränkung wird zum Ausgangspunkt einer tiefgründigen Reflexion über die Natur der Liebe, die sich in einer Mischung aus spielerischer Ironie und ernsthafter Hingabe äußert.
Das Gedicht beginnt mit einer leicht ironischen Distanzierung, indem das lyrische Ich seine Neugierde auf die Liebe bekundet, obwohl es diese noch nie wirklich erfahren hat. Die Zeilen „Ich dachte, laß doch sehn, was denn die Liebe kan, / wiewol sie sich noch nie mir recht hat kund getan!“ zeigen eine gewisse Skepsis, die jedoch schnell von der Macht der Liebe überlagert wird. Die Erwähnung der Zeitspanne von zwei Tagen, die die Trennung markiert, dient als Katalysator für das plötzliche Auftreten Cupidos. Dieser personifizierte Liebesgott wird zum direkten Akteur und Verursacher des Liebeskummers.
Die darauffolgende Konfrontation mit Cupido markiert den Wendepunkt des Gedichts. Die rhetorische Frage Cupidos, „Was aber, sprach er, ist denn diß vor ein Bescheid?“, die sich auf die verordnete Abwesenheit bezieht, wird von der Pfeilmetapher beantwortet: „Diß hier, diß war der Pfeil. Die Wunde steht weit offen.“ Diese Metapher unterstreicht die Verletzlichkeit und das schmerzhafte Gefühl, das die Liebe hervorrufen kann. Die Verwendung des Wortes „Wunde“ deutet auf die tiefe körperliche und emotionale Verletzung hin, die das lyrische Ich durch die Trennung erfährt.
Das Gedicht gipfelt in einer extremen Dichotomie, die die ganze Macht der Geliebten über das lyrische Ich verdeutlicht. Ein Kuss bedeutet Rettung, während eine abweisende Geste den sofortigen Tod zur Folge hat. „Giebst du mir einen Kuß, so hat es keine Not, / siehst du mich sauer an, so bin ich plötzlich tot.“ Diese dramatische Zuspitzung zeigt die völlige Abhängigkeit des lyrischen Ichs von der Gunst der Geliebten. Das Gedicht, das mit einer gewissen Distanz beginnt, endet in einer existenziellen Abhängigkeit von der Liebe, die durch die extreme Metaphorik und die Kürze des Textes noch verstärkt wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.