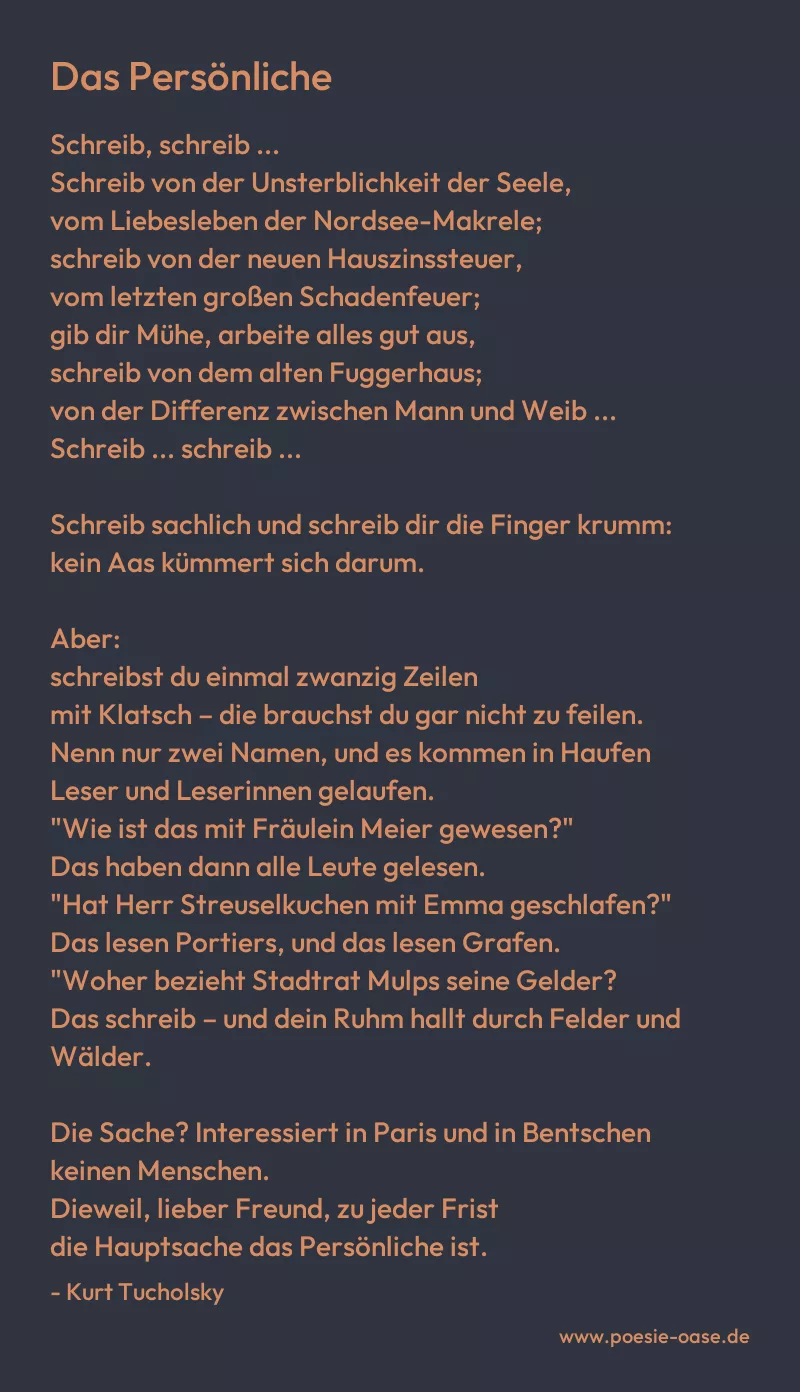Das Persönliche
Schreib, schreib …
Schreib von der Unsterblichkeit der Seele,
vom Liebesleben der Nordsee-Makrele;
schreib von der neuen Hauszinssteuer,
vom letzten großen Schadenfeuer;
gib dir Mühe, arbeite alles gut aus,
schreib von dem alten Fuggerhaus;
von der Differenz zwischen Mann und Weib …
Schreib … schreib …
Schreib sachlich und schreib dir die Finger krumm:
kein Aas kümmert sich darum.
Aber:
schreibst du einmal zwanzig Zeilen
mit Klatsch – die brauchst du gar nicht zu feilen.
Nenn nur zwei Namen, und es kommen in Haufen
Leser und Leserinnen gelaufen.
„Wie ist das mit Fräulein Meier gewesen?“
Das haben dann alle Leute gelesen.
„Hat Herr Streuselkuchen mit Emma geschlafen?“
Das lesen Portiers, und das lesen Grafen.
„Woher bezieht Stadtrat Mulps seine Gelder?
Das schreib – und dein Ruhm hallt durch Felder und Wälder.
Die Sache? Interessiert in Paris und in Bentschen
keinen Menschen.
Dieweil, lieber Freund, zu jeder Frist
die Hauptsache das Persönliche ist.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
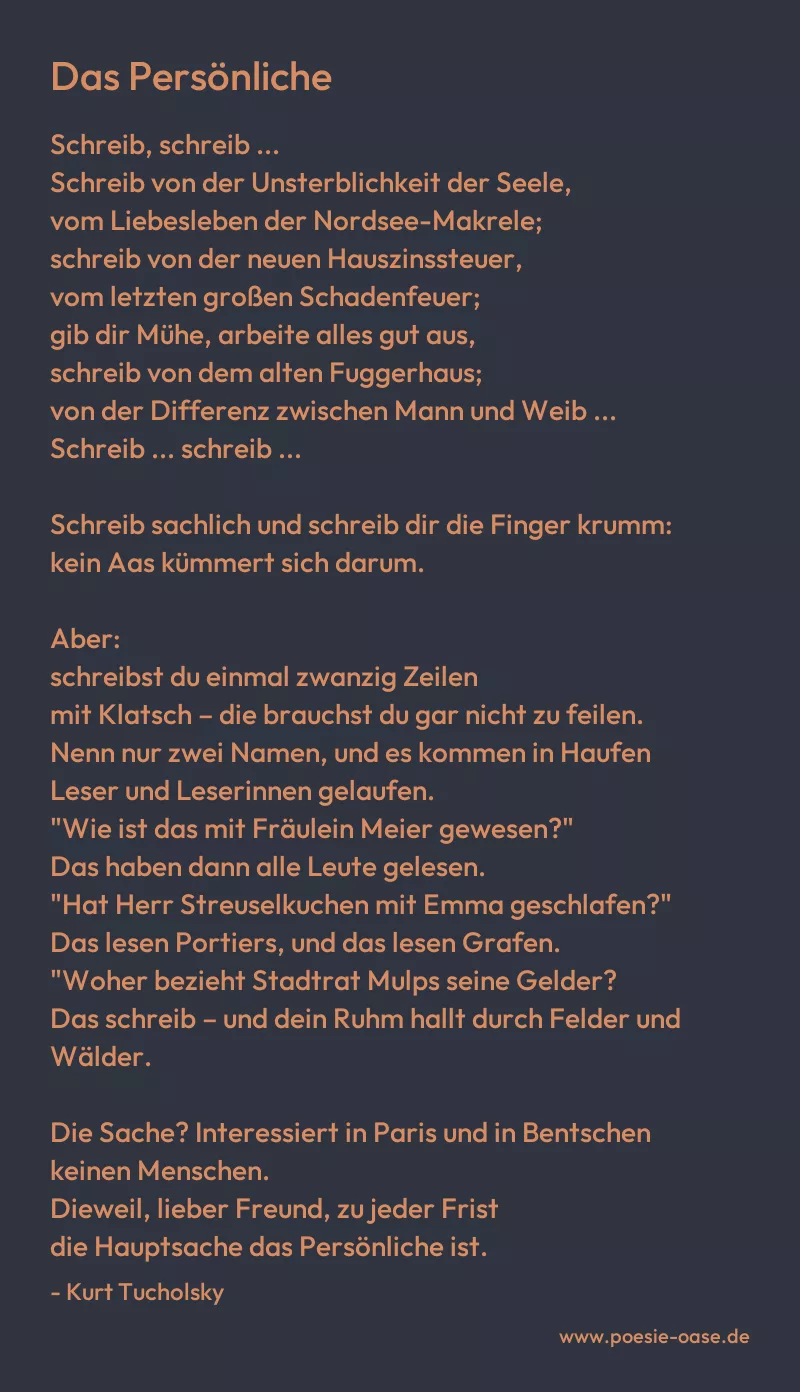
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Persönliche“ von Kurt Tucholsky ist eine bissige Satire auf die Relevanz des Sensationsjournalismus und die damit einhergehende Oberflächlichkeit des Publikums. Der Text, aufgebaut als Appell an einen imaginären Schreiber, entlarvt die Diskrepanz zwischen dem, was als wertvoll erachtet werden sollte (wissenschaftliche oder politische Themen, tiefgründige Reflexionen) und dem, was tatsächlich das Interesse der Leser weckt: Klatsch und Tratsch, das Persönliche im engsten Sinne.
Tucholsky beginnt mit einer fast ironischen Aufforderung, über scheinbar wichtige, aber letztlich irrelevante Themen zu schreiben: Unsterblichkeit der Seele, das Liebesleben von Fischen, Steuergesetze oder historische Gebäude. Diese Themen werden mit einer gewissen Distanz und fast schon spöttischer Resignation behandelt. Der Schreiber soll sich Mühe geben, doch der Autor deutet bereits die Sinnlosigkeit dieser Bemühungen an. Der zweite Teil des Gedichts konfrontiert den Leser dann mit der harten Realität: Sachliche Berichterstattung, die sich um Tatsachen und Fakten bemüht, wird ignoriert. Die Pointe kommt in Form des Gegensatzes: Nur das Persönliche, der Klatsch und die Sensationslust, findet Anklang und zieht die Massen an.
Der zweite Teil des Gedichts verdeutlicht dies durch konkrete Beispiele: Namen werden genannt, Gerüchte aufgeworfen, und die Neugier der Leser wird mit einfachen Fragen geweckt. Diese Fragen (z. B. „Wie ist das mit Fräulein Meier gewesen?“ oder „Hat Herr Streuselkuchen mit Emma geschlafen?“) sind inhaltlich trivial, entfalten aber durch ihre persönliche Natur eine enorme Anziehungskraft. Die Leser, egal welcher sozialen Schicht, scheinen sich für diese Art von Information zu begeistern. Die abschließenden Zeilen unterstreichen diese These noch einmal, indem sie die wahre Bedeutung des Persönlichen hervorheben, das weit über die sachlichen Informationen hinausgeht und zum Dreh- und Angelpunkt des Interesses geworden ist.
Die verwendete Sprache ist einfach und direkt, was die satirische Wirkung des Gedichts noch verstärkt. Tucholsky verzichtet auf komplizierte Stilmittel und konzentriert sich stattdessen auf klare, prägnante Aussagen und prägnante Reime. Die Wiederholung des Befehls „Schreib“ am Anfang und die kontrastierende Formulierung „Aber“ leiten den Wandel vom scheinbar wichtigen Thema zum Sensationsjournalismus und der menschlichen Neugier ein. Durch diese Mittel erzeugt Tucholsky einen bitteren, aber treffenden Kommentar zur menschlichen Natur und der Medienlandschaft seiner Zeit, der auch heute noch aktuell ist. Die „Hauptsache“ ist nicht die Information, sondern das Persönliche, das die Leser bindet und ihre Aufmerksamkeit fesselt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.