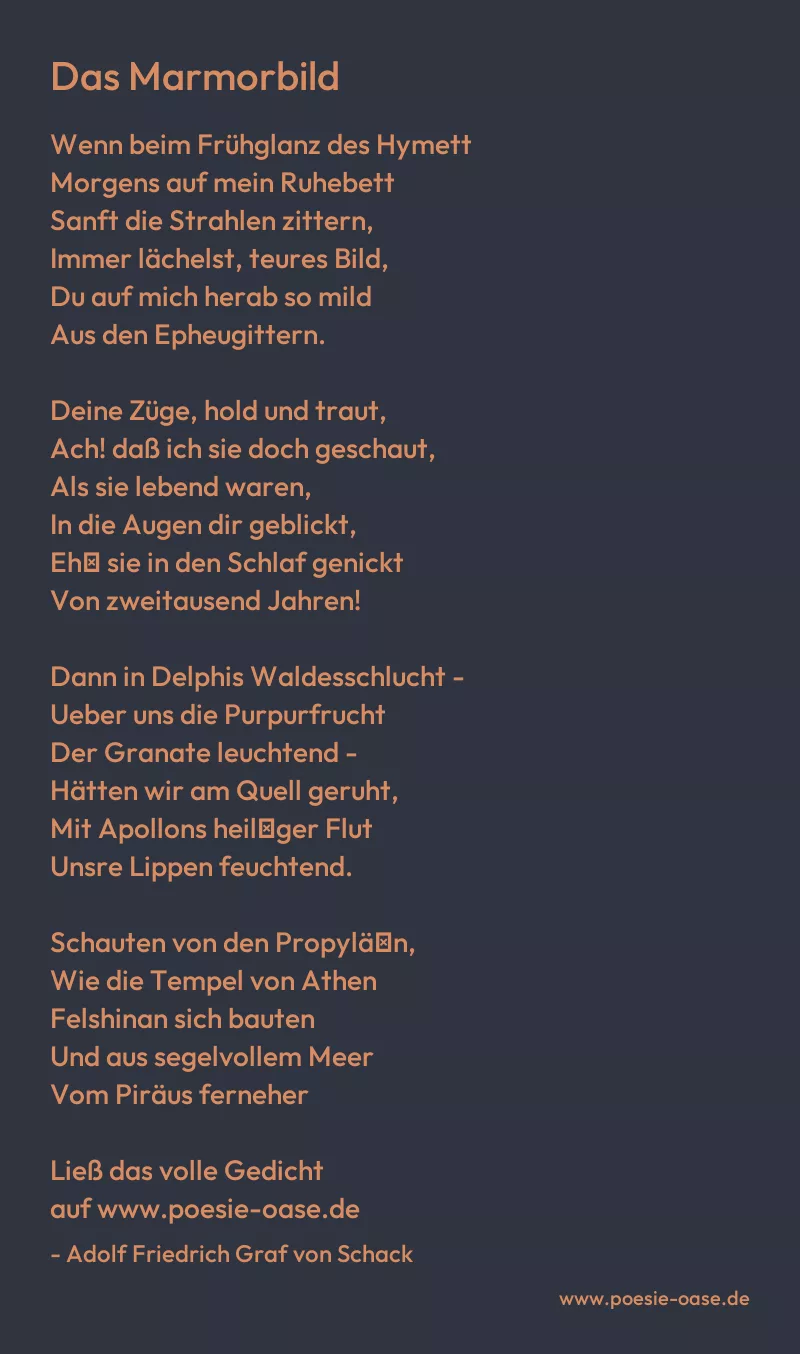Wenn beim Frühglanz des Hymett
Morgens auf mein Ruhebett
Sanft die Strahlen zittern,
Immer lächelst, teures Bild,
Du auf mich herab so mild
Aus den Epheugittern.
Deine Züge, hold und traut,
Ach! daß ich sie doch geschaut,
Als sie lebend waren,
In die Augen dir geblickt,
Eh′ sie in den Schlaf genickt
Von zweitausend Jahren!
Dann in Delphis Waldesschlucht –
Ueber uns die Purpurfrucht
Der Granate leuchtend –
Hätten wir am Quell geruht,
Mit Apollons heil′ger Flut
Unsre Lippen feuchtend.
Schauten von den Propylä′n,
Wie die Tempel von Athen
Felshinan sich bauten
Und aus segelvollem Meer
Vom Piräus ferneher
All die Inseln blauten.
Schweiften den Kephiß entlang,
Wo der Nachtigall Gesang
Nie im Walde stockte
Und auf grünem Wiesenplan
Flötenhauch der alte Pan
Aus der Syrinx lockte.
Nächtlich in Kolonos′ Hain
Lauschten wir dem Jubelreihn,
Wie die Zimbel schallte
Und der Tanz von Nymph′ und Faun
Durch die rebenvollen Aun
Labyrinthisch wallte;
Und der Chiertraube Trank
Schlürften wir im Laubgerank,
Ueberweht von Blüten,
Während bei der Leier Ton
Und Alcäus′ Skolion
Unsre Küsse glühten.
Doch was träum′ ich?
Ach, nur Gram
Bleibt mir, daß zu spät ich kam
Zu des Lebens Feste,
Und, o Weib, verweht vom Wind
Seit zweitausend Jahren sind
Deine Aschenreste.