Waldnacht. Urmächtge Eichen, unter die
Des Blitzes greller Strahl geleuchtet nie!
Dämmernde Wölbung, Ast in Ast verwebt
Von keines Vogels Lustgeschrei belebt!
Ein brütend Schweigen, nie vom Sturm gestört,
Ein heilig Dunkel, das dem Gott gehört
Darin, umblinkt von Schädel und Gebein
Sich ungewiss erhebt ein Opferstein …
Es rauscht. Es raschelt. Schritte durch den Wald!
Das kurze römische Kommando schallt.
Geleucht von Helmen! Eine Kriegerschar!
Vorauf ein Gallier und ein Legionar:
„Die Stämme können dienen. Beil in Schwung!
Cäsar braucht Widder zur Belagerung!“
Erbleichend spricht der Gallier ein Gebet
Den Römer selbst ergreift die Majestät
Des Orts, doch hebt gehorchend er die Axt –
Der Gallier flüstert: „Weisst du, was du wagst?
Die Stämme – diese Riesen – sind gefeit,
Hier wohnt ein mächtger Gott seit alter Zeit
In dessen Nähe nur der Priester tritt,
Ein totenblasses Opfer schleppt er mit.
Versehrtest nur ein Blatt du freventlich
Stracks kehrte sich die Waffe wider dich!“ …
Die heilgen Eichen drohen Baum an Baum
Die Römer lauschen bang und atmen kaum,
Schwer, schwerer wird der Hand des Beiles Wucht
Und ihr entsinkts. Sie stürzen auf die Flucht.
„Steht!“ und sie stehn. Denn es ist Cäsars Ruf
Der ihre Seelen sich zu Willen schuf!
Er ist bei seiner Schar. Er deutet hin
Auf eine Eiche. Sie umschlingen ihn,
Sie decken ihn wie im Gedräng der Schlacht,
Sie flehn. Er ringt. Er hat sich losgemacht,
Er schreitet vor. Sie folgen. Er ergreift
Ein Beil, hebts, führt den Schlag, der saust und pfeift …
Sank er verwundet von dem frevlen Beil? Er
lächelt: „Schauet Kinder, ich bin heil.
Erstaunen! Jubel! Hohngelächter! Spott!
Soldatenwitz: „Verendet hat der Gott!“
Die Rinde fliegt! Des Stammes Stärke kracht!
Vom Laub zu dunklerm Laube flieht die Nacht.
Die Beile tun ihr Werk. Die Wölbung bricht,
Und Riesentrümmer überströmt das Licht.
Das Heiligtum
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
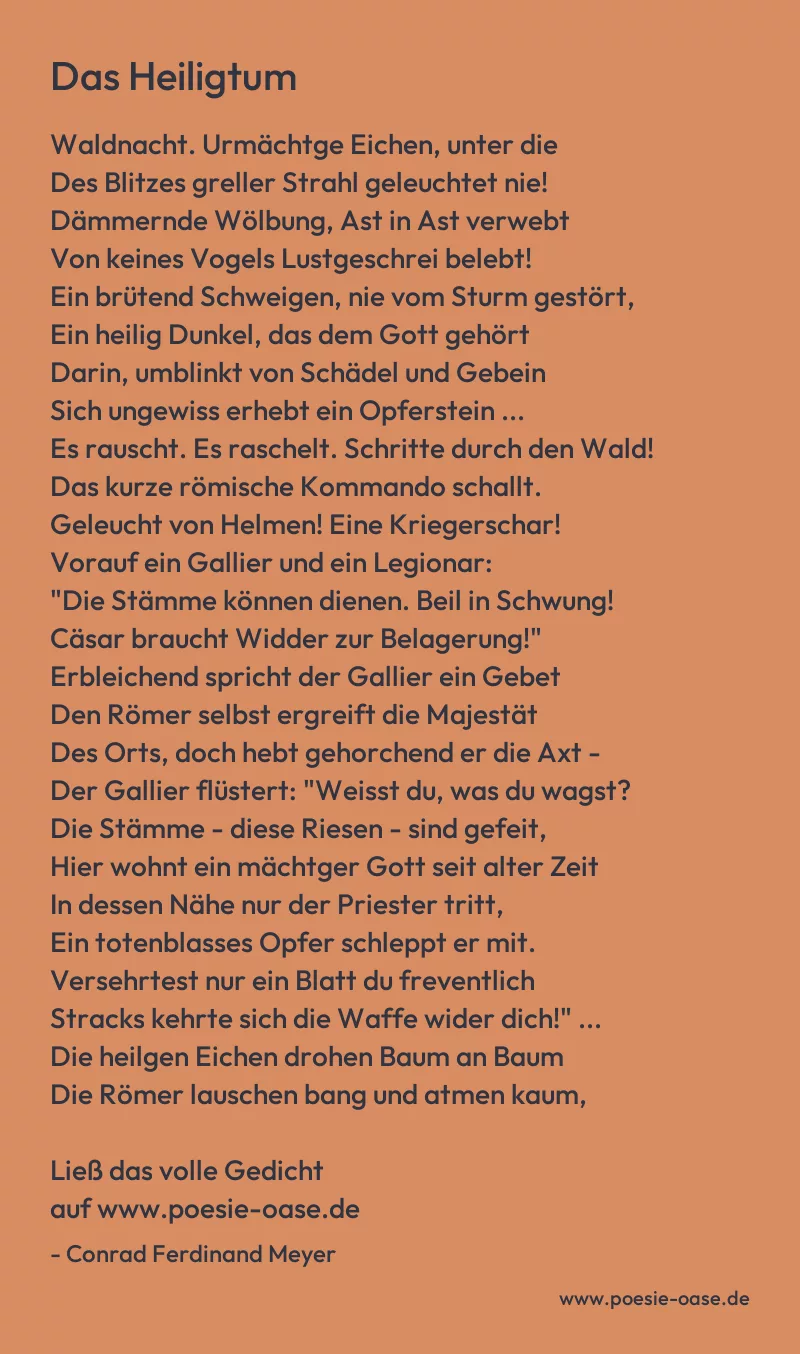
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Heiligtum“ von Conrad Ferdinand Meyer ist eine beeindruckende Ballade, die von der Zerstörung eines heidnischen Heiligtums durch römische Legionäre erzählt und die Konfrontation zweier Welten, des römischen Imperiums und der alten, naturnahen Religionen, thematisiert. Es ist ein Kampf zwischen Macht und Spiritualität, zwischen rationalem Fortschritt und dem Glauben an das Übernatürliche.
Die Szenerie ist zunächst geprägt von einer mystischen, fast unheimlichen Atmosphäre. Meyers Beschreibung der Eichen, des dämmernden Waldes und des tiefen Schweigens erzeugt ein Gefühl der Ehrfurcht und des Respekts vor dem heiligen Ort. Die „urmächtge Eichen“, der „Opferstein“ und das „heilige Dunkel“ suggerieren eine tiefe spirituelle Bedeutung, die durch die Anwesenheit des „Gottes“ und die Warnung des Galliers vor dem Zerstören der Bäume verstärkt wird. Der Dichter verwendet eine bildreiche Sprache, um die Erhabenheit und Unberührtheit des Ortes hervorzuheben.
Die eigentliche Handlung beginnt mit dem Einfall der römischen Soldaten unter Cäsar. Die Befehle und das Auftreten der Legionäre stehen im krassen Gegensatz zur Stille und dem Geheimnis des Waldes. Der Kontrast wird durch die Reaktion des Galliers und des Römers deutlich, die beide die spirituelle Macht des Ortes zu spüren scheinen. Die Angst der Soldaten und die plötzliche Flucht nach dem ersten Befehl zeugen von der Ehrfurcht, die sie vor der Naturgewalt empfinden.
Der Höhepunkt des Gedichts ist die Tat Caesars. Trotz der Warnungen und der offensichtlichen Ehrfurcht der Soldaten handelt er unerschrocken und fällt die Eiche. Die Reaktionen der Soldaten – Erstaunen, Jubel, Hohn und Spott – zeigen die Auflösung des Glaubens an die alten Götter und den Triumph der römischen Macht. Meyers Verwendung von Ironie, wie im abschließenden Soldatenwitz „Verendet hat der Gott!“, unterstreicht die Zerstörung des Heiligtums und den Sieg der menschlichen Vernunft. Der letzte Vers mit dem fallenden Licht, welches die Trümmer überströmt, symbolisiert den Verlust der alten Welt und den Einbruch des neuen, römischen Zeitalters.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
