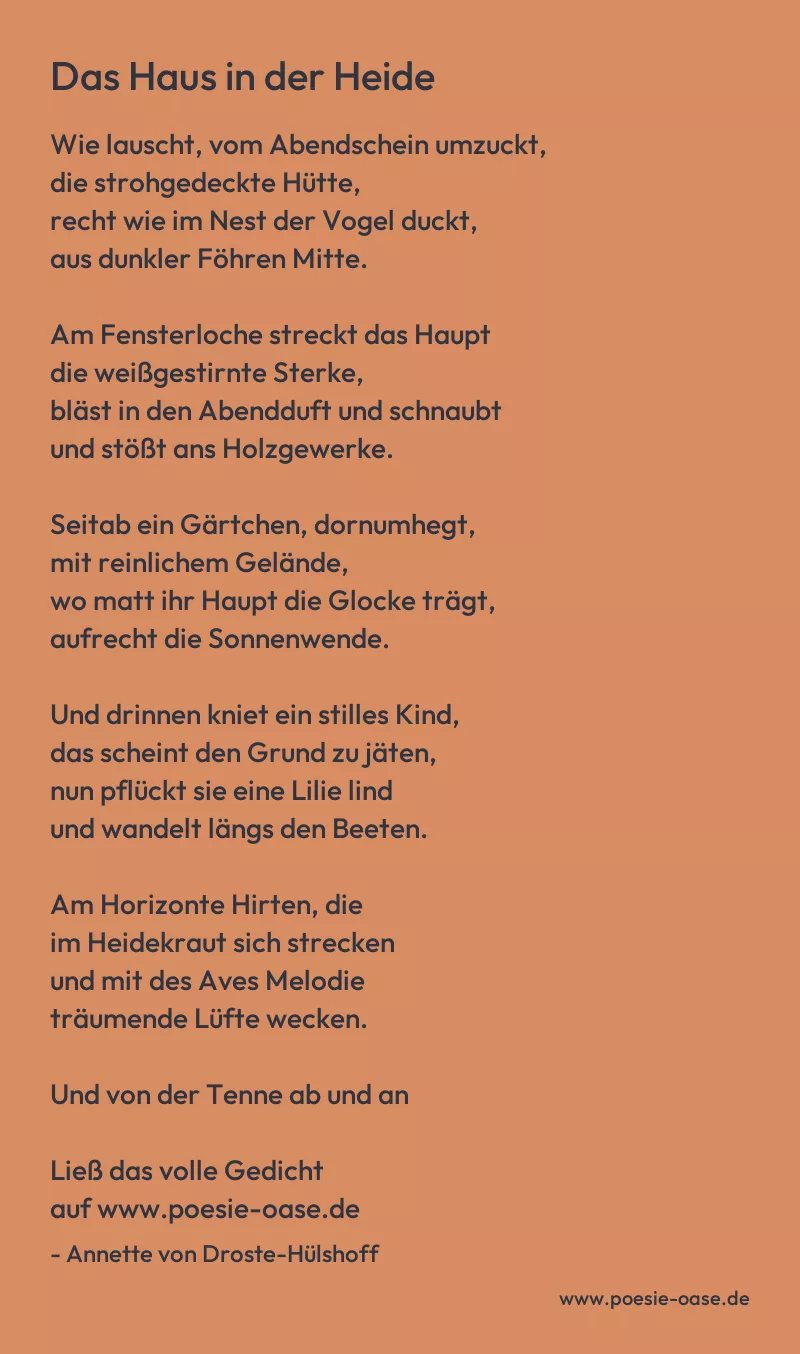Wie lauscht, vom Abendschein umzuckt,
die strohgedeckte Hütte,
recht wie im Nest der Vogel duckt,
aus dunkler Föhren Mitte.
Am Fensterloche streckt das Haupt
die weißgestirnte Sterke,
bläst in den Abendduft und schnaubt
und stößt ans Holzgewerke.
Seitab ein Gärtchen, dornumhegt,
mit reinlichem Gelände,
wo matt ihr Haupt die Glocke trägt,
aufrecht die Sonnenwende.
Und drinnen kniet ein stilles Kind,
das scheint den Grund zu jäten,
nun pflückt sie eine Lilie lind
und wandelt längs den Beeten.
Am Horizonte Hirten, die
im Heidekraut sich strecken
und mit des Aves Melodie
träumende Lüfte wecken.
Und von der Tenne ab und an
schallt es wie Hammerschläge,
der Hobel rauscht, es fällt der Span,
und langsam knarrt die Säge.
Da hebt der Abendstern gemach
sich aus den Föhrenzweigen,
und grade ob der Hütte Dach
scheint er sich mild zu neigen.
Es ist ein Bild, wie still und heiß
es alte Meister hegten,
kunstvolle Mönche, und mit Fleiß
es auf den Goldgrund legten:
Der Zimmermann – die Hirten gleich
mit ihrem frommen Liede,
die Jungfrau mit dem Lilienzweig,
und rings der Gottesfriede.
Des Sternes wunderlich Geleucht
aus zarten Wolkenfloren –
Ist etwa hier im Stall vielleicht
Christkindlein heut geboren?