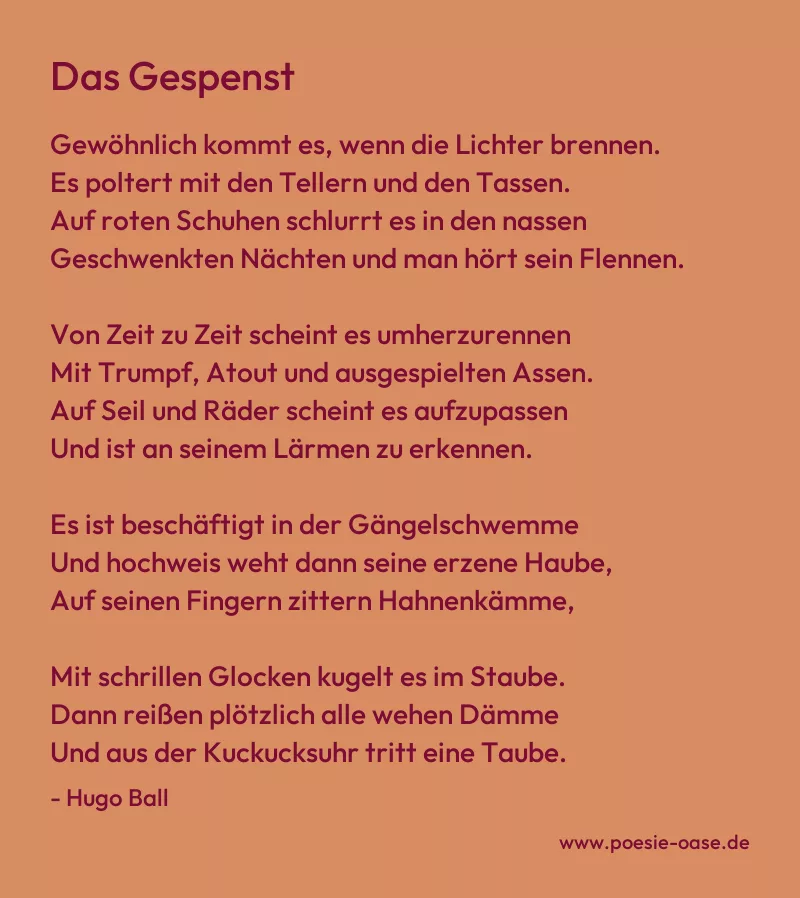Das Gespenst
Gewöhnlich kommt es, wenn die Lichter brennen.
Es poltert mit den Tellern und den Tassen.
Auf roten Schuhen schlurrt es in den nassen
Geschwenkten Nächten und man hört sein Flennen.
Von Zeit zu Zeit scheint es umherzurennen
Mit Trumpf, Atout und ausgespielten Assen.
Auf Seil und Räder scheint es aufzupassen
Und ist an seinem Lärmen zu erkennen.
Es ist beschäftigt in der Gängelschwemme
Und hochweis weht dann seine erzene Haube,
Auf seinen Fingern zittern Hahnenkämme,
Mit schrillen Glocken kugelt es im Staube.
Dann reißen plötzlich alle wehen Dämme
Und aus der Kuckucksuhr tritt eine Taube.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
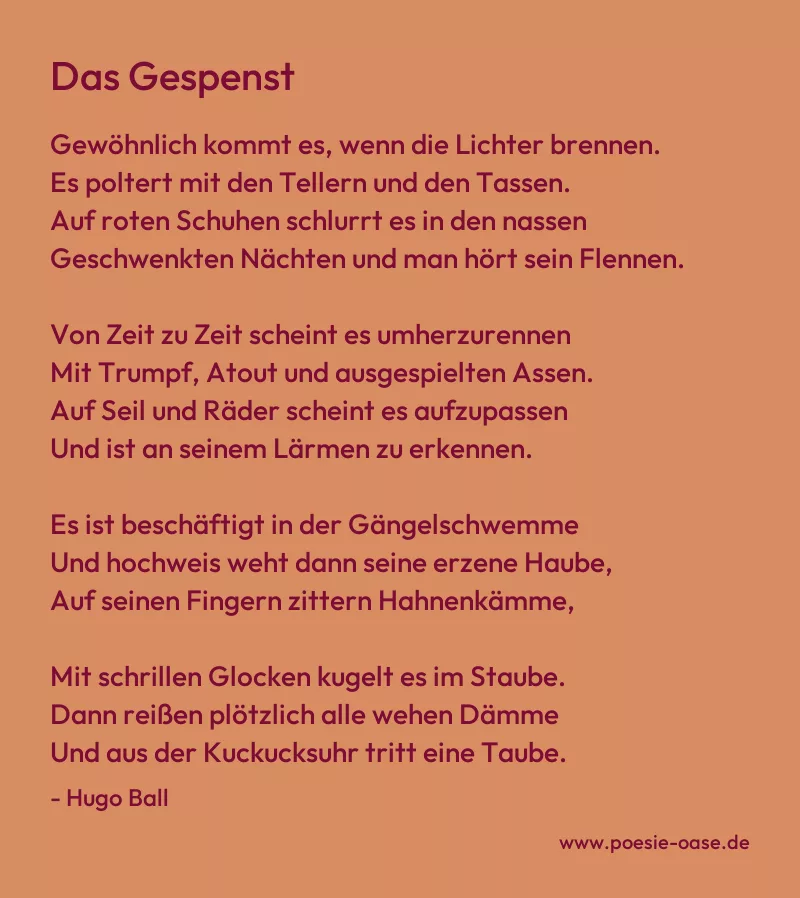
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Gespenst“ von Hugo Ball zeichnet ein verstörendes Bild einer unheimlichen Präsenz, die in alltäglichen Situationen ihr Unwesen treibt. Die Sprache ist geprägt von einer Mischung aus konkreten Bildern und rätselhaften Andeutungen, die ein Gefühl der Verunsicherung und des Unbehagens erzeugen. Der Autor verzichtet auf eine eindeutige Erklärung, wodurch die Interpretation offen gehalten und die Vorstellungskraft des Lesers angeregt wird. Das Gespenst manifestiert sich in den scheinbar gewohnten Umständen des Hauses und erzeugt durch sein Auftreten Chaos und Unruhe.
Die ersten beiden Strophen beschreiben das Gespenst in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Es zeigt sich als lärmende, unberechenbare Entität, die sowohl in den einfachen Dingen des Haushalts – wie dem Poltern mit Tellern und Tassen – als auch in scheinbar spielerischen Aktivitäten wie Kartenspielen aktiv ist. Die „roten Schuhe“ und das „Flennen“ deuten auf eine düstere, vielleicht gar kindliche oder dämonische Wesenheit hin. Die Erwähnung von „Trumpf, Atout und ausgespielten Assen“ könnte auf eine Verbindung zur Welt des Glücksspiels und des Schicksals hindeuten, wodurch die Ungewissheit über die Natur des Gespenstes weiter verstärkt wird.
In der dritten Strophe verdichtet sich das Bild des Gespenstes zu einer noch bizarreren Gestalt. Es ist in der „Gängelschwemme“ beschäftigt, ein möglicherweise metaphorischer Ort, der auf eine chaotische und unkontrollierte Umgebung hindeutet. Die „erzene Haube“ und die „Hahnenkämme“ auf den Fingern erzeugen ein surreales Bild, das an mittelalterliche Figuren oder Fantasiewesen erinnert. Diese Elemente verstärken den Eindruck des Unheimlichen und des Fremdartigen, der vom Gespenst ausgeht.
Der Schluss des Gedichts kulminiert in einer überraschenden und rätselhaften Auflösung. Das Gespenst scheint schließlich die Kontrolle zu verlieren, und „alle wehen Dämme reißen plötzlich“. Aus der „Kuckucksuhr tritt eine Taube“, was den Leser mit einem unerwarteten, vielleicht sogar hoffnungsvollen Bild zurücklässt. Dies könnte als ein Zeichen der Befreiung oder des Übergangs gedeutet werden, aber auch als eine weitere Facette des Geheimnisvollen, das das gesamte Gedicht durchzieht. Das Ende bleibt offen und lädt den Leser dazu ein, über die Bedeutung des Gespenstes und seine Auswirkungen auf die Welt nachzudenken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.