Trüb brennt der Schenke Kerzenlicht,
Der Wirtin junges Angesicht,
Ermüdet, schlummertrunken,
Nickt auf die Brust gesunken,
Denn schon ist Mitternacht vorbei.
Am Schiefertische spielen zwei,
Die weissen Würfel schallen,
Schlecht ist der Wurf gefallen –
Ein junges wildes Augenpaar
Droht aus verworrnem Lockenhaar:
„Das war mein letztes Silberstück!
Doch wenden muss sich jetzt das Glück!
Du, Alter, musst mir borgen!
Wir spielen bis zum Morgen!,
Mit grünen Katzenaugen blitzt
Der andre, der im Dunkel sitzt:
„Lass dich zu Bette legen,
Die Mutter spricht den Segen!“
Des Jungen Faust zerdrückt das Glas
Mit einem Fluch – „Kind, weisst du was?
,Ein Schlösslein steht auf grünem Plan′,
So fängt ein altes Märchen an.
Ich meine das im Walde,
Hier oben an der Halde.
Verschlossen sind die Fenster,
Drin hausen nur Gespenster
Für den, der an Gespenster glaubt –
Sobald das Jahr den Wald entlaubt,
Macht sich der Herr von hinnen
Von diesen luftgen Zinnen –
Schwelgt in der Stadt im Marmorsaal
Und spielt bei lustgem Kerzenstrahl.
Kling, kling! Ich hör es klingen,
Wie goldne Füchse springen …
Dein Vater – ward mir recht gesagt? –
War Pächter und ist ausgejagt …
Da weisst du droben ein und aus,
Du kennst den Hund, du kennst das Haus –
Ich borge mir mein Spielgeld frisch
Von dieses reichen Mannes Tisch!
Nimm, was da liegt, nimm was da steht,
Ein Prunkgeschirr ein Goldgerät,
Mir darfst dus gleich verhandeln,
Ich kanns in Münze wandeln.
Von selber öffnet sich der Schrein,
Du müsstest nicht ein Schlosser sein …“
Der Bursche lauscht mit dumpfem Hirn
Dem höllischen Gemunkel,
Ein Schatten steht auf seiner Stirn,
Ein Schatten tief und dunkel:
Und wieder leis und lüstern
Beginnt das grimme Flüstern:
„Kurt, sieh den Lauf der Welt dir an!
Was wohl gelingt, ist wohl getan!
Betrachte dir die Taten
Der grossen Diplomaten,
Die klugen Herrn verstehn den Pfiff,
Ein leiser Schritt, ein sichrer Griff!
Dann spielt man hübsch Verstecken
Und lässt sich nicht entdecken –
Du blickst so wild, als wolltst du mich
Erstechen, Kurt, besinne dich!
Wo suchst du deine Schlüssel, Kurt?
Du trägst den ganzen Bund am Gurt!“ …
Er stürzt hinaus, empört, betört,
Die Wirtin, die ihn schreiten hört,
Lallt halb im Traum, sie weiss nicht wie:
„Wie gehts der Mutter? Grüsse sie!“
Er taumelt in die Nacht hinaus,
Um seine Stirn fliegt ein Gebraus
Betrunkener Gedanken
Und seine Schritte wanken.
Er stürmt empor die Strecke
Zum Schloss auf Schnees Decke,
Das Gitter übersteigt er leis,
Und knisternd bricht das Tannenreis,
Er schleicht und nach der Leiter langt
Er, die am Dach der Scheune hangt,
Er steht am Herrenhause schon,
Er klettert über den Balkon,
Sein Herz, er hört es pochen …
Und hat die Tür erbrochen.
Rasch ist ein Wachslicht angebrannt,
Laut kracht es in der Täfelwand,
Ihm steigt das Haar, hin starrt er wild
Und sieht ein farbenlieblich Bild,
Von lichtem Reif umgeben,
Sich aus dem Düster heben.
Den Schlummer eines Knaben sieht
Er, neben dem die Mutter kniet,
Die blauen Augen strahlen licht
Von einer guten Zuversicht.
Nicht kann den Blick er wenden
Von diesen flehnden Händen …
Da muss mit Tränenbächen
Die harte Rinde brechen –
Dumpf klirrend fällt der Schlüsselbund.
Die Mutter dankt mit frohem Mund.
Er flüchtet über den Balkon,
Die Leiter trägt er schnell davon,
Als wandelt er auf Gluten –
Und wendet sich zum Guten.
Das Gemälde
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
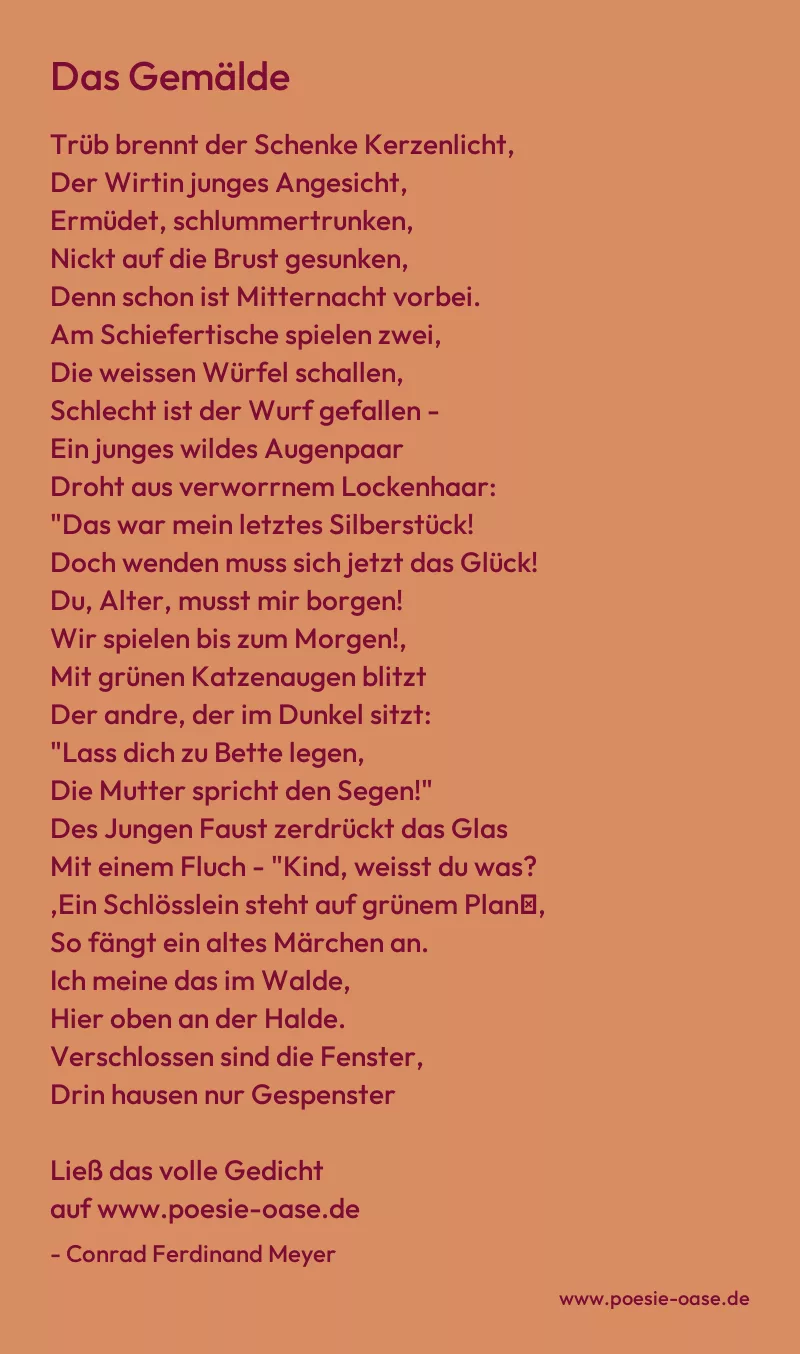
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Gemälde“ von Conrad Ferdinand Meyer entfaltet eine komplexe Geschichte, die von Gier, Verführung und letztendlich der Läuterung handelt. Das Gedicht beginnt in einer düsteren Schenke, wo der junge Kurt gegen einen älteren Mann um sein letztes Geld spielt. Der ältere Mann, eine Figur von zwielichtigem Charakter, versucht Kurt zu verführen, indem er ihm von einem verlassenen Schloss erzählt, das Reichtümer birgt.
Die zentrale Metapher des Gedichts ist das Gemälde, das Kurt im Schloss entdeckt. Dieses Bild zeigt einen schlafenden Knaben und seine betende Mutter, die eine Aura der Unschuld und Hoffnung ausstrahlen. Die Gegenüberstellung von Kurts düsterer Realität und der idyllischen Szene des Gemäldes bildet den Kern der moralischen Botschaft des Gedichts. Der ältere Mann verkörpert die Versuchung, die in Form von materieller Gier und kurzsichtigem Vergnügen auftritt, während das Gemälde für die Werte steht, die Kurt beinahe vergisst: Familie, Unschuld und ein tugendhaftes Leben.
Die Sprache des Gedichts ist reich an Bildern und Symbolen. Die düstere Atmosphäre der Schenke, die flüsternden Worte des älteren Mannes, die dunklen Schatten und das verlassene Schloss erzeugen eine unheimliche Spannung. Der Kontrast zum Licht des Gemäldes und der warmherzigen Darstellung der Mutter und des Kindes verstärkt die emotionale Wirkung auf den Leser. Die Verwendung von Reim und Rhythmus, typisch für Meyers Werk, trägt zur Dramatik und zur eindringlichen Wirkung des Gedichts bei.
Die Wendung des Gedichts liegt in Kurts Reaktion auf das Gemälde. Statt der versprochenen Reichtümer erkennt er die Bedeutung der Werte, die durch das Bild repräsentiert werden. Der Schlüsselbund, den er fallen lässt, symbolisiert die Abkehr von der Gier und die Rückkehr zum Guten. Dies ist ein Moment der Läuterung, der seine innere Transformation verdeutlicht. Kurt flieht aus dem Schloss und wendet sich der Tugend zu.
Insgesamt ist „Das Gemälde“ eine eindringliche Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, der Verführung durch materielle Werte und der Möglichkeit der Erlösung. Meyer gelingt es, eine spannende Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig eine tiefgründige moralische Botschaft vermittelt. Das Gedicht verdeutlicht die Wichtigkeit, inmitten der Versuchungen des Lebens, Werte wie Familie, Unschuld und ein tugendhaftes Leben zu bewahren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
