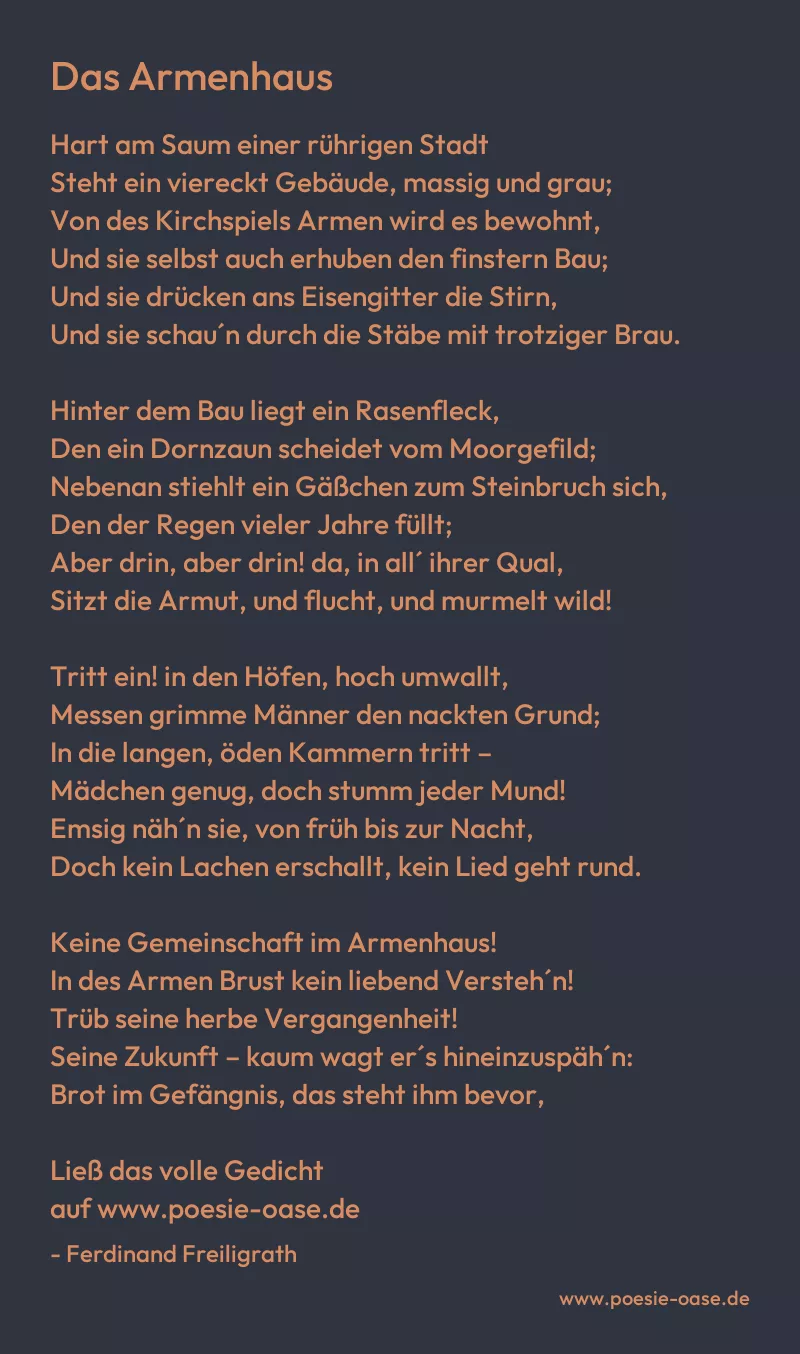Hart am Saum einer rührigen Stadt
Steht ein viereckt Gebäude, massig und grau;
Von des Kirchspiels Armen wird es bewohnt,
Und sie selbst auch erhuben den finstern Bau;
Und sie drücken ans Eisengitter die Stirn,
Und sie schau´n durch die Stäbe mit trotziger Brau.
Hinter dem Bau liegt ein Rasenfleck,
Den ein Dornzaun scheidet vom Moorgefild;
Nebenan stiehlt ein Gäßchen zum Steinbruch sich,
Den der Regen vieler Jahre füllt;
Aber drin, aber drin! da, in all´ ihrer Qual,
Sitzt die Armut, und flucht, und murmelt wild!
Tritt ein! in den Höfen, hoch umwallt,
Messen grimme Männer den nackten Grund;
In die langen, öden Kammern tritt –
Mädchen genug, doch stumm jeder Mund!
Emsig näh´n sie, von früh bis zur Nacht,
Doch kein Lachen erschallt, kein Lied geht rund.
Keine Gemeinschaft im Armenhaus!
In des Armen Brust kein liebend Versteh´n!
Trüb seine herbe Vergangenheit!
Seine Zukunft – kaum wagt er´s hineinzuspäh´n:
Brot im Gefängnis, das steht ihm bevor,
Oder Hunger draußen im Windesweh´n!
Wo ist die Lachende, die vordem
Ihren Vater umspielt am ländlichen Hag?
Wo der Knab´, dessen Auge der Mutter Licht,
Auf des Haupt ihre segnende Rechte lag?
Getrennt, geschieden, (so will´s das Gesetz!)
Abgesperrt voneinander bei Nacht und bei Tag.
O, sie lehren in ihren Schulen viel –
Nur das eine, was die Natur lehrt, nicht!
Nur nicht, was das Kind an die Eltern knüpft:
Nur nicht opfernde Liebe, freudige Pflicht!
O, nichts Gutes lernt man, wo töricht und hart
Der Natur und dem Herzen den Stab man bricht!
Siebenzehn Sommer – und wo das Kind,
Die nicht aufwuchs an ihres Vaters Knie?
Zwanzig Herbste – und wo der Knab´,
Den ein Mutterwort unterwiesen nie?
Er, in Ketten, schafft an der Südsee Strand;
In den Gassen bei Nacht ihr Brot sucht sie
O Weisheit, o Macht, o Gesetz – blickt herab
Auf die schmachtende Armut von eurer Höh´!
O, trennt keine Herzen, die Gott verband,
Eins zu sein in Wohl und in Weh!
O ihr Ernsten, die ihr am Ruder steht –
Dachtet ihr dieses Ernstes je?
O Reichtum, komm und öffne die Hand!
O Mildigkeit, komm und schließe den Bund!
Gib dem Alter, der Jugend! der Liebe gib!
Segne, erfreue, mache gesund!
Doch zu spät! denn ich höre – und morgen schon!–
Der Rebellentrommel fordernden Ton
Schüttern den festen englischen Grund!