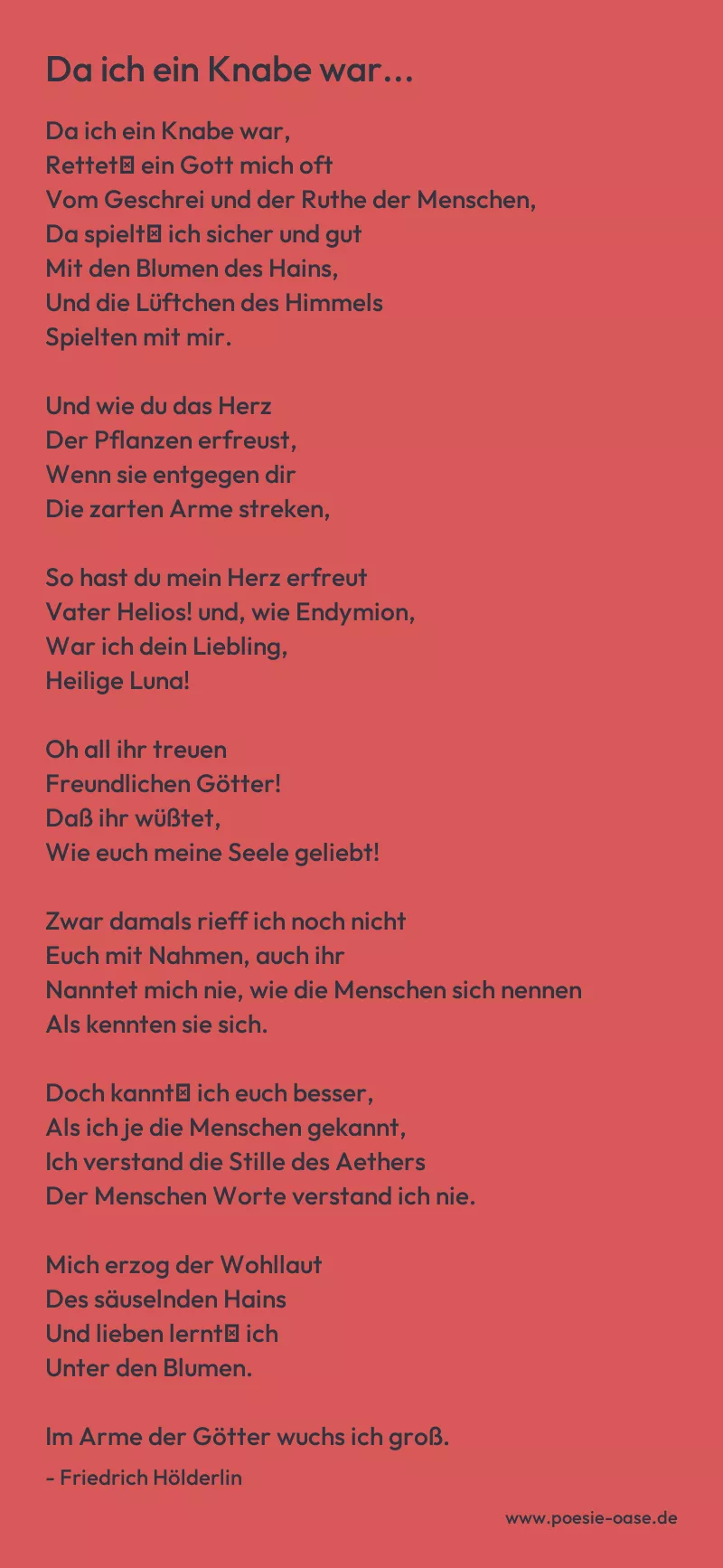Da ich ein Knabe war…
Da ich ein Knabe war,
Rettet′ ein Gott mich oft
Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen,
Da spielt′ ich sicher und gut
Mit den Blumen des Hains,
Und die Lüftchen des Himmels
Spielten mit mir.
Und wie du das Herz
Der Pflanzen erfreust,
Wenn sie entgegen dir
Die zarten Arme streken,
So hast du mein Herz erfreut
Vater Helios! und, wie Endymion,
War ich dein Liebling,
Heilige Luna!
Oh all ihr treuen
Freundlichen Götter!
Daß ihr wüßtet,
Wie euch meine Seele geliebt!
Zwar damals rieff ich noch nicht
Euch mit Nahmen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen
Als kennten sie sich.
Doch kannt′ ich euch besser,
Als ich je die Menschen gekannt,
Ich verstand die Stille des Aethers
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Mich erzog der Wohllaut
Des säuselnden Hains
Und lieben lernt′ ich
Unter den Blumen.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
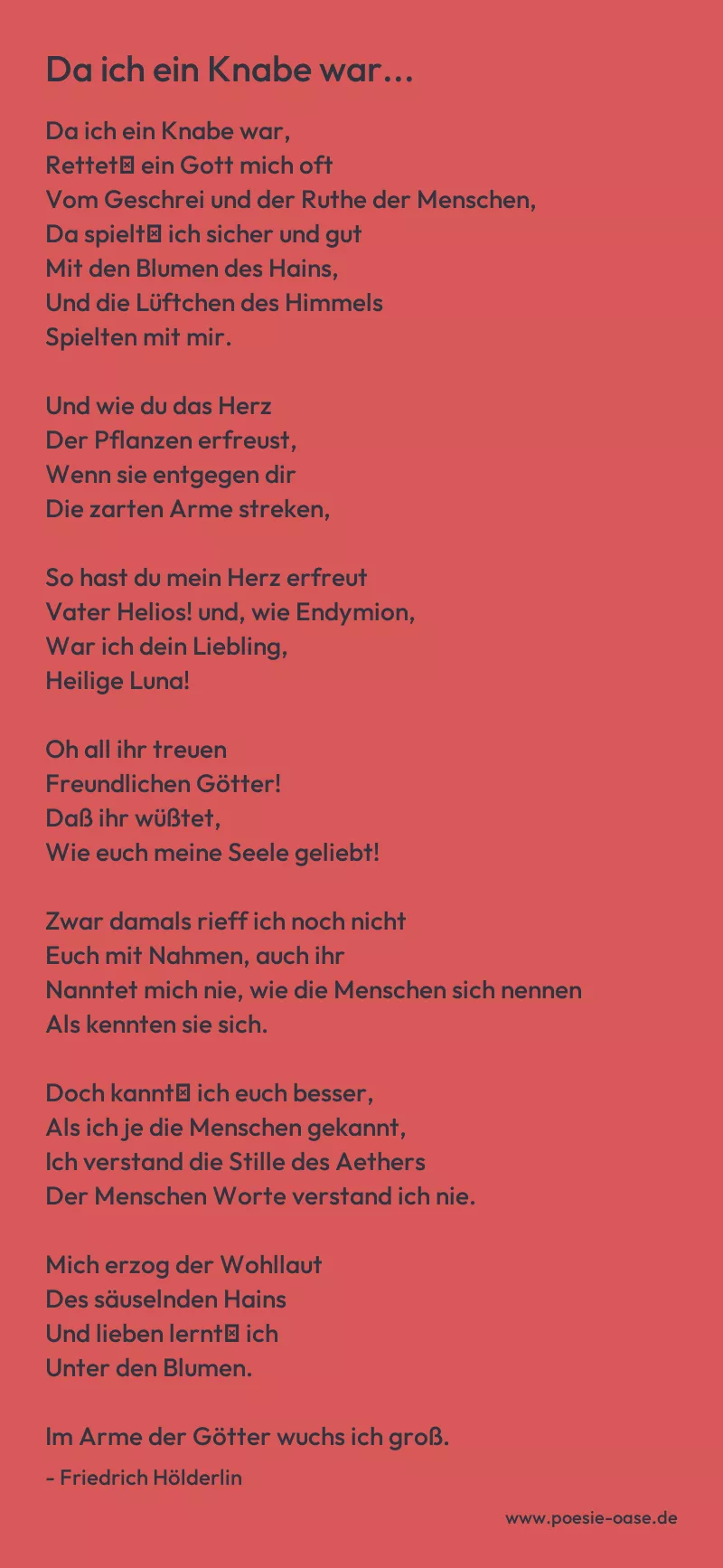
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Da ich ein Knabe war…“ von Friedrich Hölderlin ist eine melancholische Rückbesinnung auf die Unschuld und das enge Verhältnis des lyrischen Ichs zur Natur und zu den Göttern in der Kindheit. Es zeichnet sich durch einen einfachen, fast kindlichen Sprachstil aus, der die Innigkeit und die ungetrübte Freude der damaligen Zeit hervorhebt. Die Verse sind frei fließend, ohne ein starres Reimschema, was den Eindruck von Natürlichkeit und Spontaneität verstärkt und die Erinnerungen des Sprechers lebendig werden lässt.
Im Zentrum des Gedichts steht die enge Verbindung des Kindes mit der Natur und den Göttern. Die Zeilen „Rettet‘ ein Gott mich oft / Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen“ deuten auf eine Distanz zur Welt der Erwachsenen und ihren Zwängen hin. Das Kind findet Schutz und Geborgenheit in der Natur, symbolisiert durch „die Blumen des Hains“ und „die Lüftchen des Himmels“, mit denen es unbeschwert spielt. Auch die Götter, insbesondere Helios und Luna, spielen eine wichtige Rolle. Die Liebe und Wertschätzung für die Götter ist in den Zeilen „So hast du mein Herz erfreut / Vater Helios! und, wie Endymion, / War ich dein Liebling, / Heilige Luna!“ erkennbar, was die kindliche Hingabe und das Vertrauen in die göttliche Welt unterstreicht.
Die Verwendung von Ausrufen und direkten Anreden an die Götter, wie in „Oh all ihr treuen / Freundlichen Götter!“, verstärkt den Eindruck der kindlichen Verehrung und des unerschütterlichen Glaubens. Das lyrische Ich scheint sich in der Kindheit in einer Harmonie mit der Natur und den Göttern befunden zu haben, die ihm in der Welt der Erwachsenen abhanden gekommen ist. Die Zeilen „Zwar damals rieff ich noch nicht / Euch mit Nahmen, auch ihr / Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen / Als kennten sie sich.“ deuten darauf hin, dass das Kind die Götter intuitiv verstand, ohne sie namentlich benennen zu müssen, im Gegensatz zu den Erwachsenen, die sich durch ihre oberflächlichen Beziehungen auszeichnen.
Das Gedicht endet mit einer idealisierten Vorstellung der Kindheit, in der das lyrische Ich „im Arme der Götter“ aufwuchs. Dies deutet auf ein verlorenes Paradies hin, eine Zeit der Unschuld und der Verbundenheit, die im Laufe des Lebens durch die Erfahrungen und Enttäuschungen der Welt verloren geht. Die Natur wird hier als Quelle der Erziehung und der Liebe dargestellt, was die Sehnsucht nach einer Rückkehr in diese ursprüngliche Harmonie widerspiegelt. Das Gedicht ist somit eine elegische Betrachtung der Kindheit und des Verlustes der kindlichen Unschuld und Verbundenheit mit der Natur und den Göttern.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.