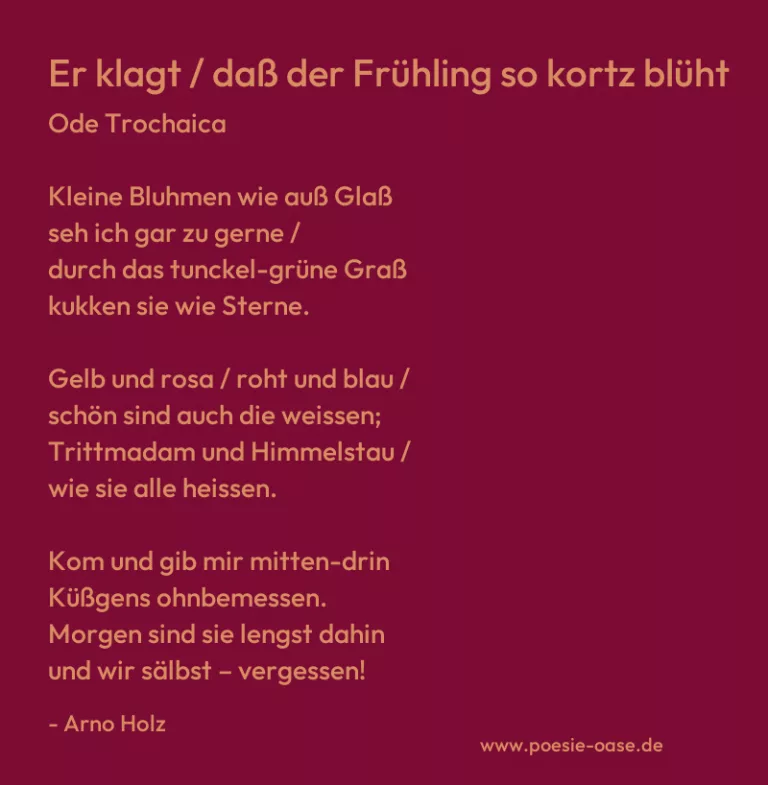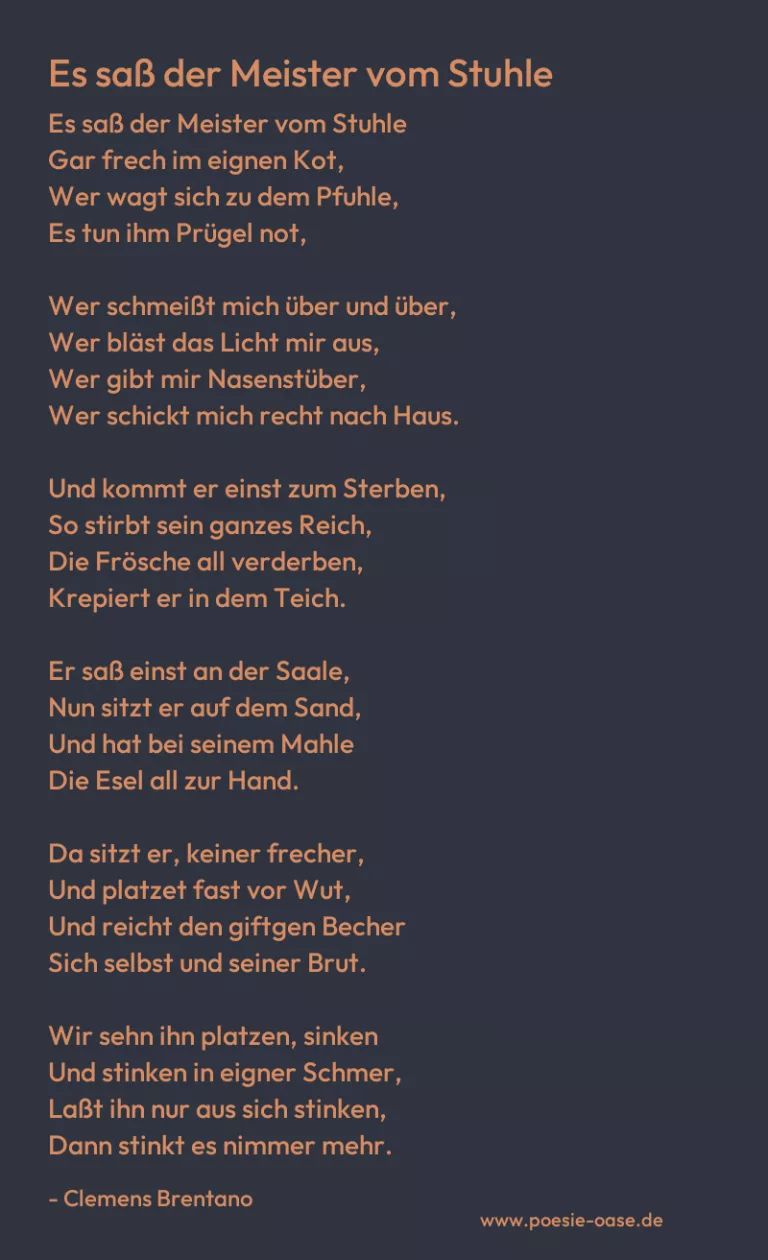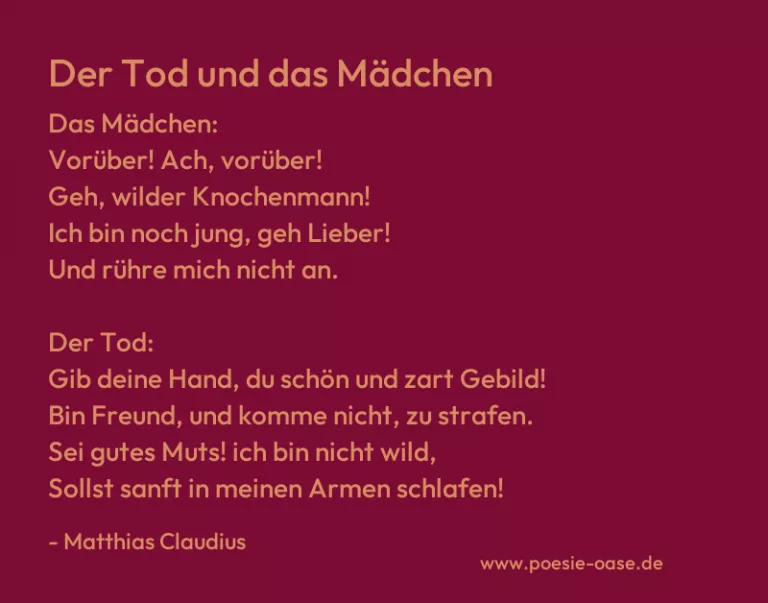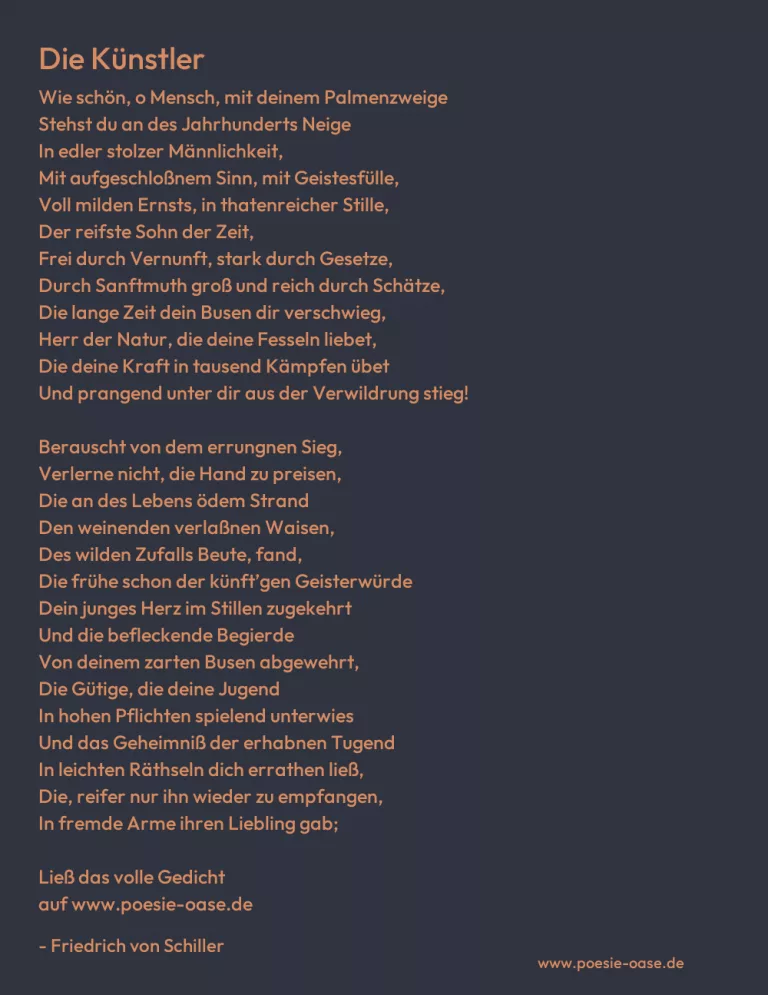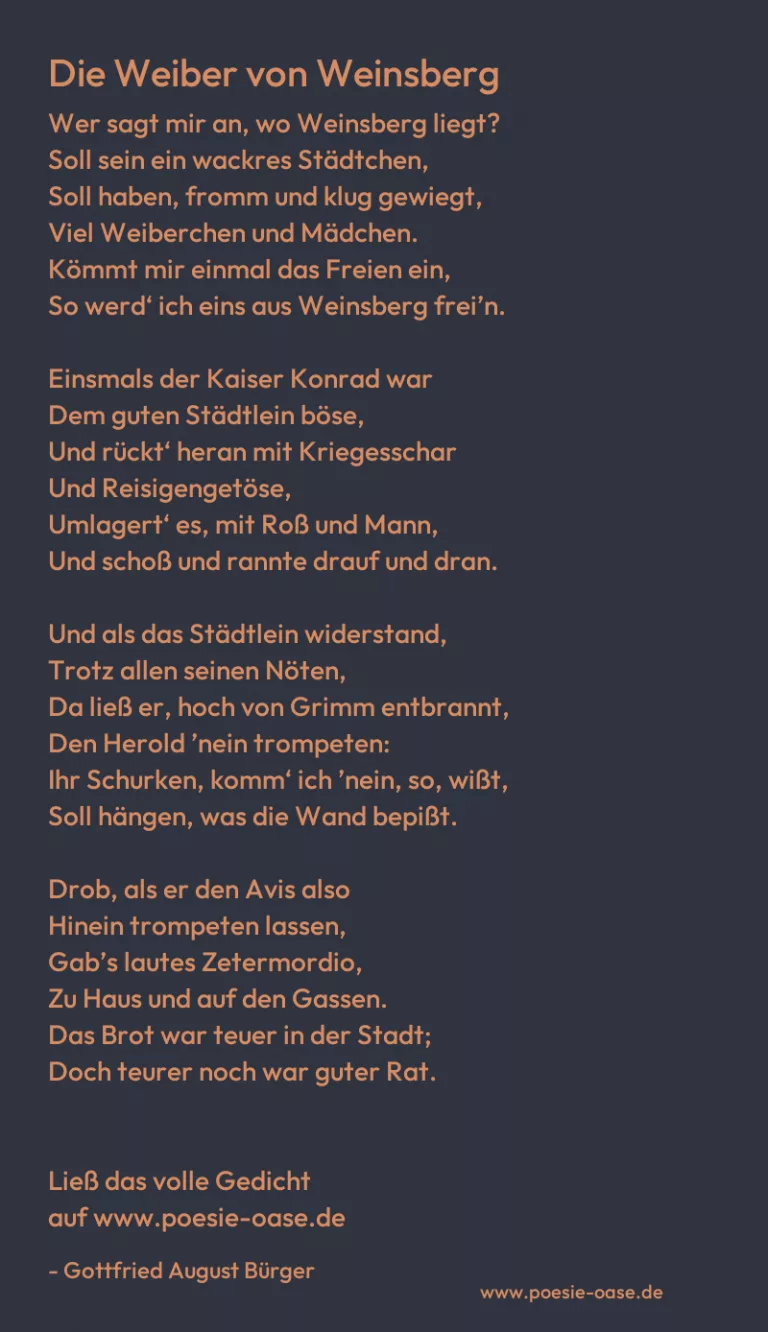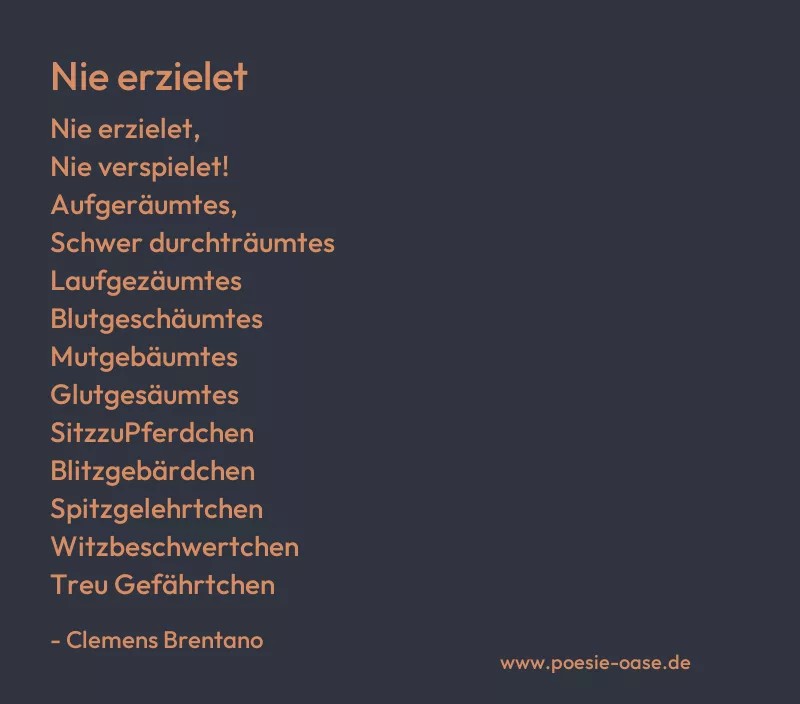Nie erzielet
Nie erzielet,
Nie verspielet!
Aufgeräumtes,
Schwer durchträumtes
Laufgezäumtes
Blutgeschäumtes
Mutgebäumtes
Glutgesäumtes
SitzzuPferdchen
Blitzgebärdchen
Spitzgelehrtchen
Witzbeschwertchen
Treu Gefährtchen
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
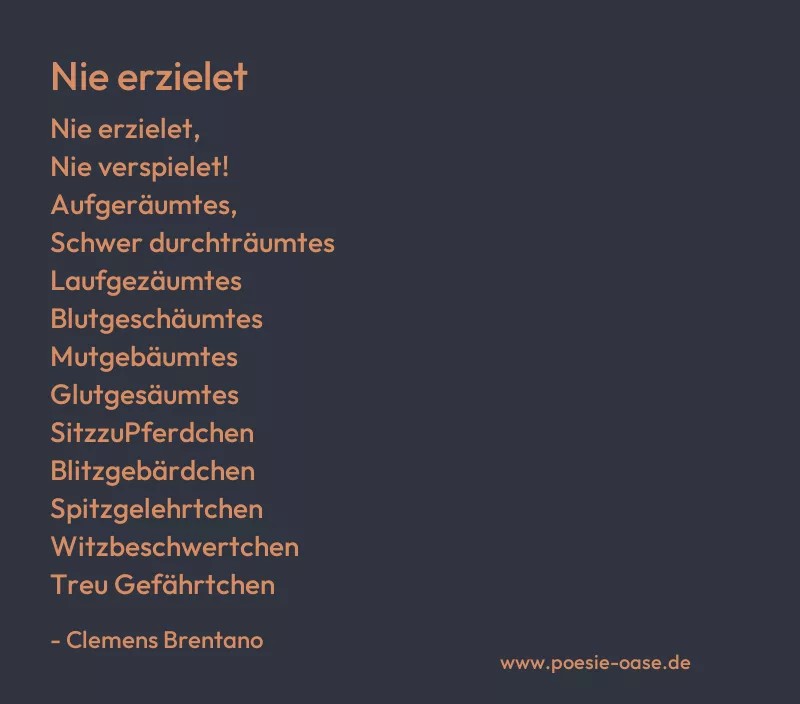
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nie erzielet“ von Clemens Brentano ist ein sprachspielerisches, rhythmisch pointiertes Miniaturwerk, das durch seine Lautmalerei, seine Wiederholungen und Wortneuschöpfungen besticht. Es handelt sich um ein typisches Beispiel romantischer Sprachkunst, in der Klang, Rhythmus und Assoziation wichtiger sind als eine lineare Erzählstruktur oder klare Bedeutung.
Der Text entfaltet sich in einer Reihe kompakter, zusammengesetzter Begriffe, die wie ein bewegtes, beinahe galoppierendes Klangbild wirken. Begriffe wie „Laufgezäumtes“, „Blutgeschäumtes“ oder „Mutgebäumtes“ evozieren ein reitendes, kämpferisches Bild – vielleicht das eines Pferdes oder Reiters in stürmischer Bewegung, das nie „erzielet“ (d.h. nie getroffen oder bezwungen) wurde. Diese Wortschöpfungen verbinden Körperlichkeit mit Emotionalität und suggerieren ein freies, unbändiges Wesen.
Im Wechsel von Konsonanz und Assonanz entsteht ein spielerischer Rhythmus, der trotz der Kürze eine intensive Dynamik erzeugt. Besonders die Endsilben -chen und -tchen in „SitzzuPferdchen“, „Blitzgebärdchen“, „Spitzgelehrtchen“ wirken kindlich, fast verniedlichend, was dem Gedicht eine ironisch-humorvolle Brechung verleiht. Dadurch oszilliert das Gedicht zwischen Ernst und Spiel, Pathos und Leichtigkeit.
Die letzte Zeile „Treu Gefährtchen“ lässt sich als emotionale Klammer verstehen. Nach all den wilden, widersprüchlichen Bildern steht am Ende eine zärtliche, treue Bindung – vielleicht zu einem Tier, vielleicht zu einem Menschen, vielleicht zur Poesie selbst. Brentano nutzt hier die volle Bandbreite sprachlicher Freiheit, um einen kleinen poetischen Kosmos zu erschaffen, der sich jeder eindeutigen Deutung entzieht und gerade dadurch seinen Reiz entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.