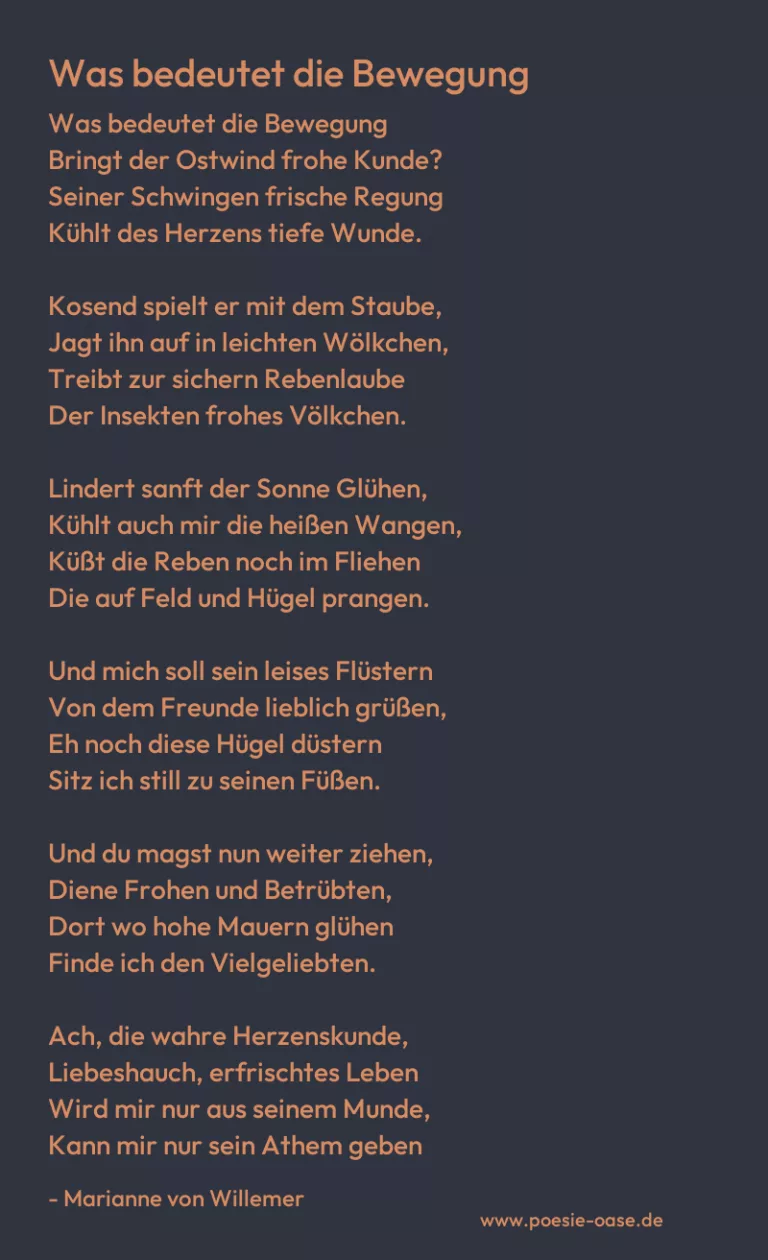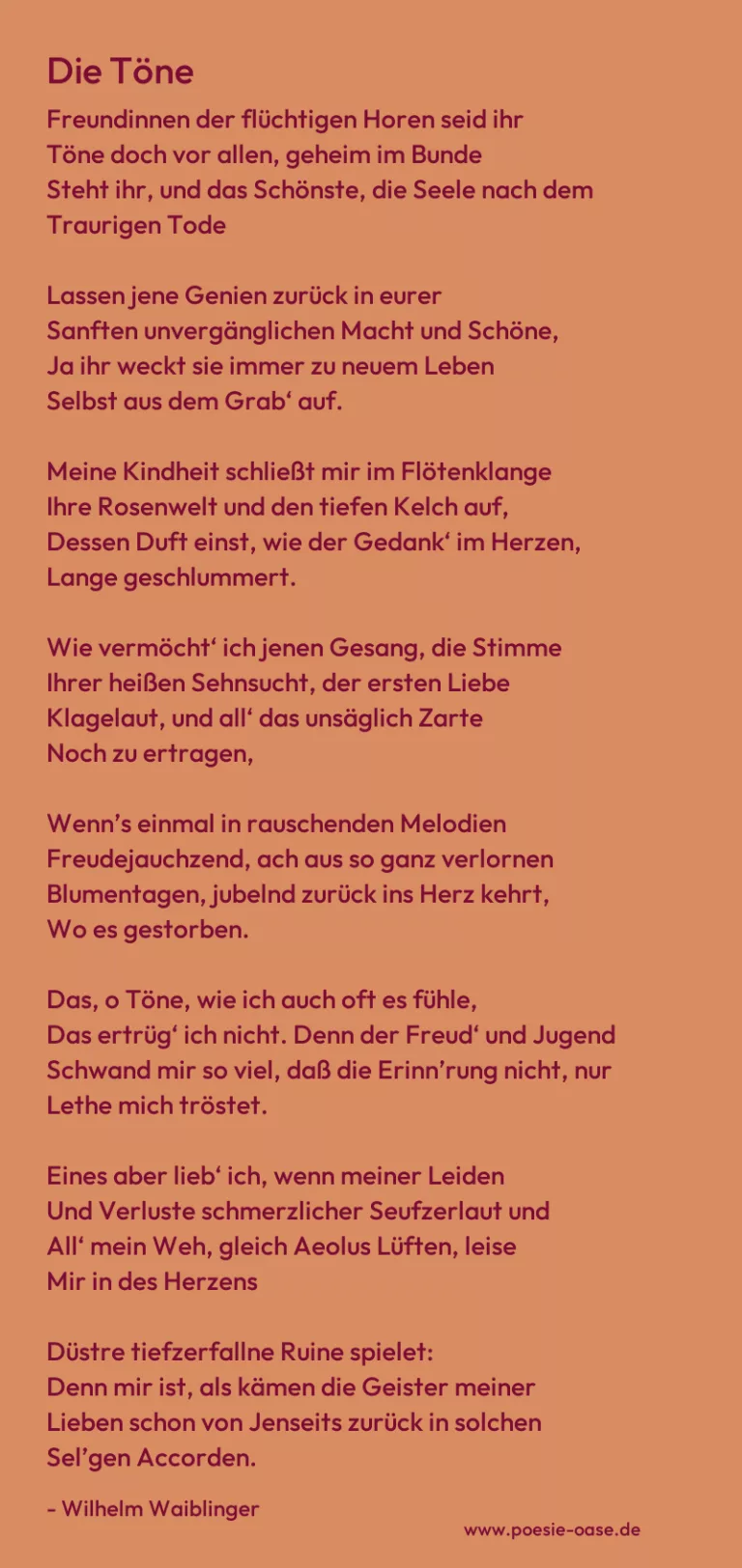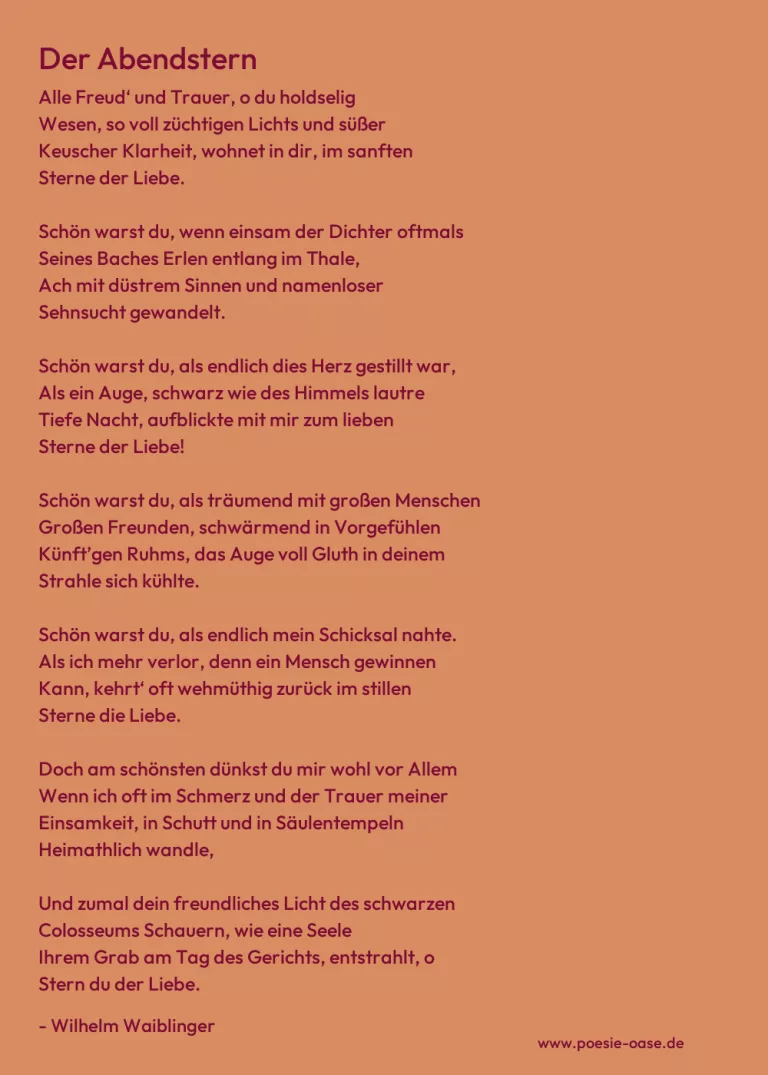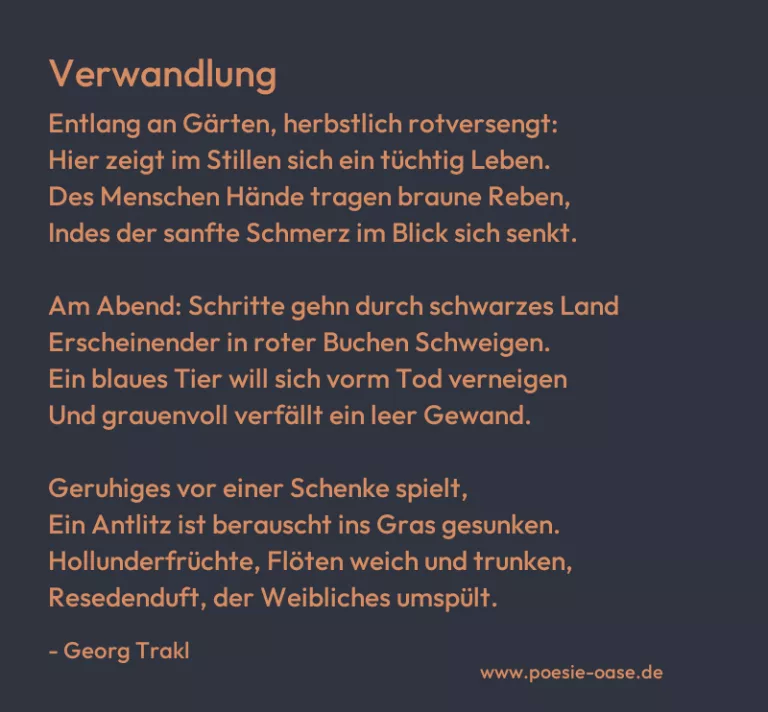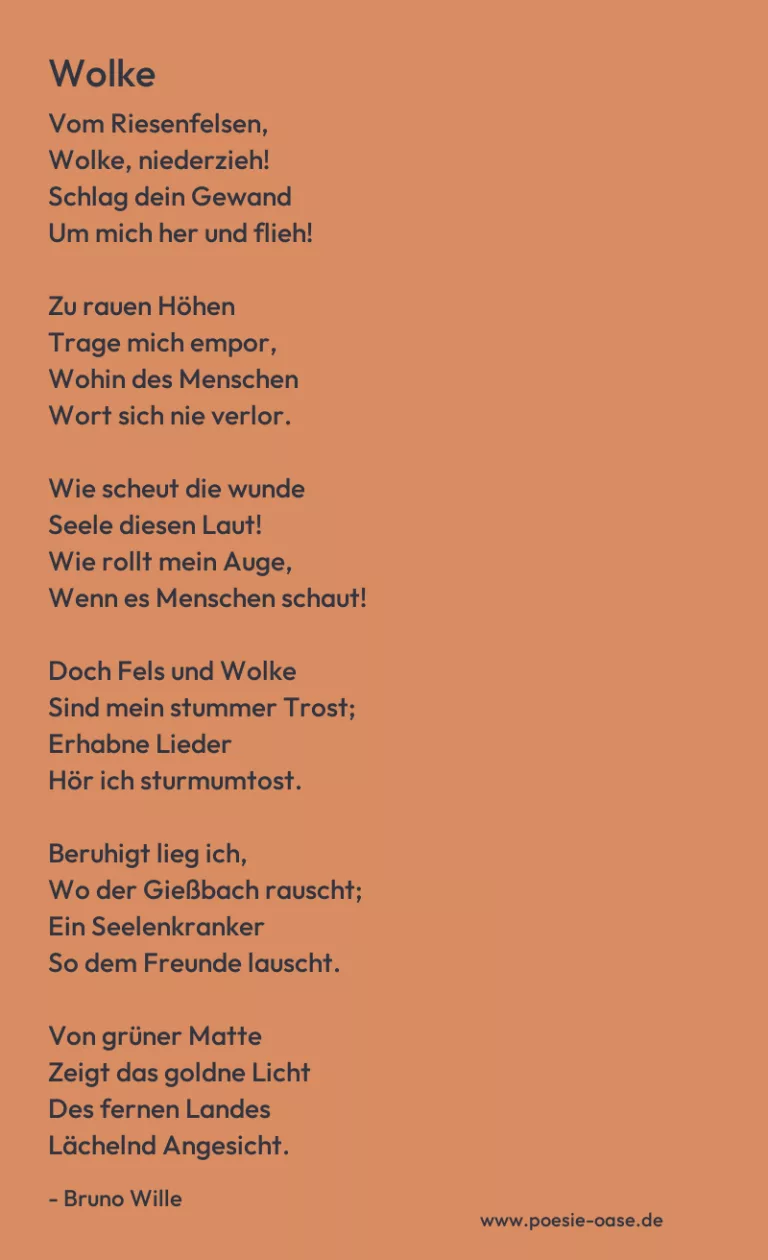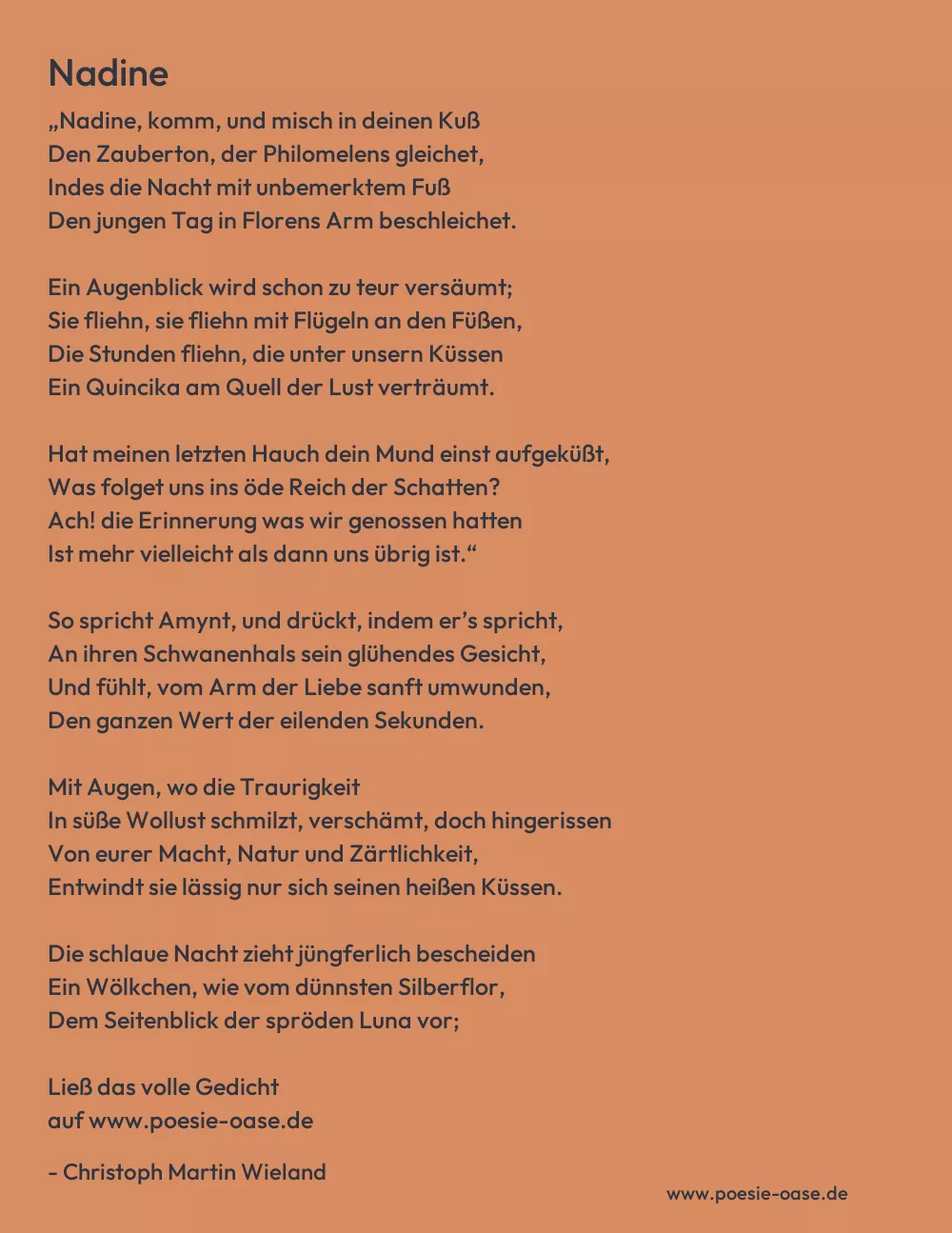„Nadine, komm, und misch in deinen Kuß
Den Zauberton, der Philomelens gleichet,
Indes die Nacht mit unbemerktem Fuß
Den jungen Tag in Florens Arm beschleichet.
Ein Augenblick wird schon zu teur versäumt;
Sie fliehn, sie fliehn mit Flügeln an den Füßen,
Die Stunden fliehn, die unter unsern Küssen
Ein Quincika am Quell der Lust verträumt.
Hat meinen letzten Hauch dein Mund einst aufgeküßt,
Was folget uns ins öde Reich der Schatten?
Ach! die Erinnerung was wir genossen hatten
Ist mehr vielleicht als dann uns übrig ist.“
So spricht Amynt, und drückt, indem er’s spricht,
An ihren Schwanenhals sein glühendes Gesicht,
Und fühlt, vom Arm der Liebe sanft umwunden,
Den ganzen Wert der eilenden Sekunden.
Mit Augen, wo die Traurigkeit
In süße Wollust schmilzt, verschämt, doch hingerissen
Von eurer Macht, Natur und Zärtlichkeit,
Entwindt sie lässig nur sich seinen heißen Küssen.
Die schlaue Nacht zieht jüngferlich bescheiden
Ein Wölkchen, wie vom dünnsten Silberflor,
Dem Seitenblick der spröden Luna vor;
Ein Rosenbusch wächst schnell um sie empor,
Und ungesehn umflattert sie ein Chor
Von
Liebesgöttern
und von
Freuden
.
Nur Einer aus der kleinen Schar
Ein junger
Scherz
, von dreisterem Geschlechte,
Den eine
Grazie
dem schönsten
Faun
gebar,
Setzt schalkhaft auf dem braunen Haar
An deiner Stirn, Nadine, sich zurechte.
Amynt wird ihn zuletzt gewahr,
Und will den losen Gaukler fangen;
Allein der Scherz, der leicht von Füßen war,
Entschlüpft, und flieht in eins der Grübchen ihrer Wangen.
Auch hier verfolget ihn Amynt.
Nun, denkt er, soll mir’s doch in ihren Lippen glücken!
Ja! wäre nicht sein Gegner schnell besinnt
Den kleinen Gott mit Küssen zu ersticken.
Er zappelt, wie ein junger Aal
Im feuchten Netz, und schlägt und sträubt sich mit den Flügeln,
Bis zwischen sanft erhabnen Hügeln
Von warmem Schnee ein dämmernd Rosental
Sich ihm entdeckt. – Er glitscht an einer Leiter
Von Bändern unvermerkt herab.
Umsonst! Der Mund, der keine Rast ihm gab,
Folgt ihm durch Berg und Tal, und treibt ihn immer weiter.
Wohin, o Venus, soll er fliehn?
Wo kann er zu entrinnen hoffen?
Wie soll er sich der Schmach, erhascht zu sein, entziehn?
Wo ist noch eine Zuflucht offen?
So wie ein Reh, vom frühen Horn erweckt,
Mit raschem Lauf, der kaum das Gras berühret,
Von Bergen flieht, dann steht, die Ohren reckt,
Dann schneller eilt, vom Nachhall fortgeschreckt,
Und sich zuletzt in einen Hain verlieret,
Wo krauser Büsche Nacht ihm seinen Feind versteckt:
So eilt der schlaue
Scherz
, ganz atemlos vor Schrecken,
So leis er kann in eine Freistatt sich,
Wo ihn sein Jäger sicherlich
Nicht suchen werde, zu verstecken.
Der Flüchtling glaubt, in Paphos tiefstem Hain,
Wo, unentdeckt sogar bei Sonnenschein,
Sich Amor oft an Spröden schon gerochen,
Glaubt in Cytherens Heiligtum,
In Dädals Labyrinth, ja im Elysium
Nicht sicherer zu sein als wo er sich verkrochen.
Allein der Liebesgötter Schar
Die, Bienen gleich, doch unsichtbar,
In Trauben an Nadinens Wangen,
An ihrem Rosenmund, an ihrem Busen hangen,
Bemerkten bald die reizende Gefahr,
Und schrien laut – als es zu späte war:
„Ach! Brüderchen, du bist gefangen!“