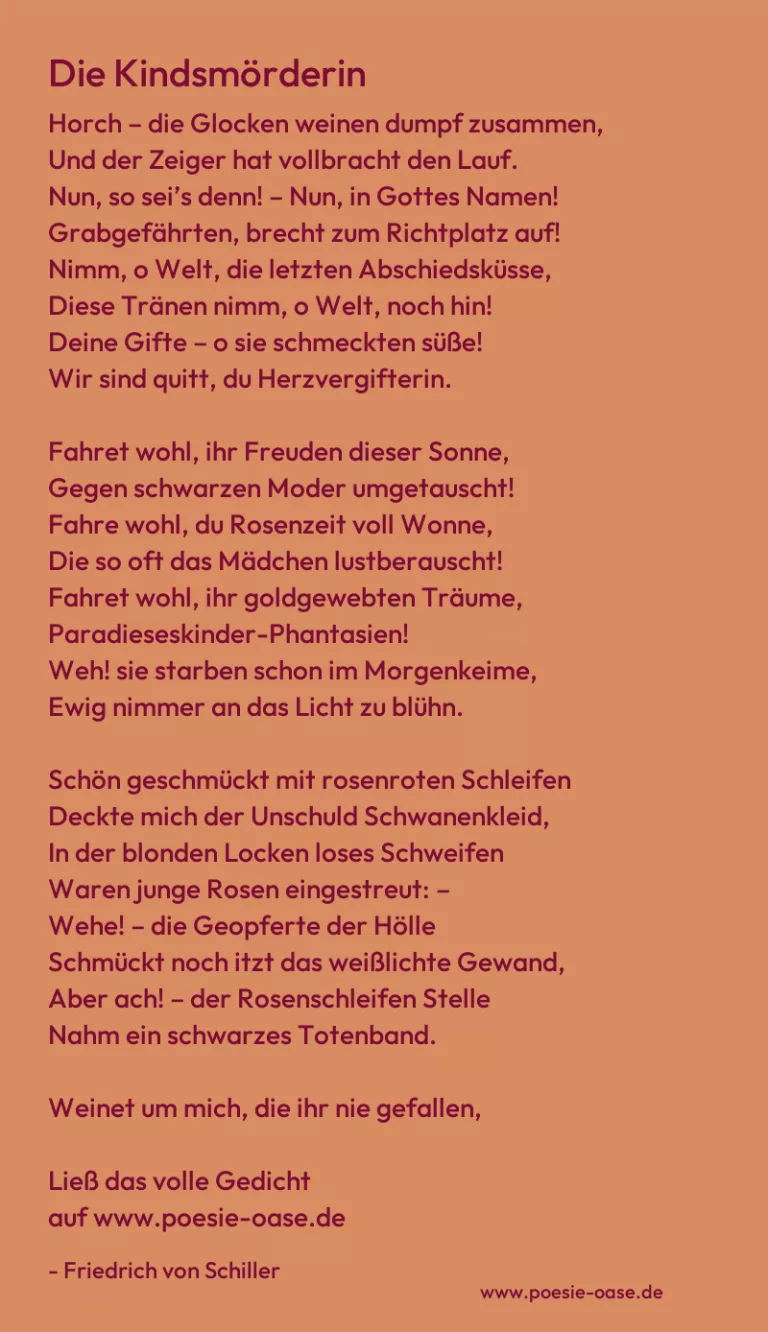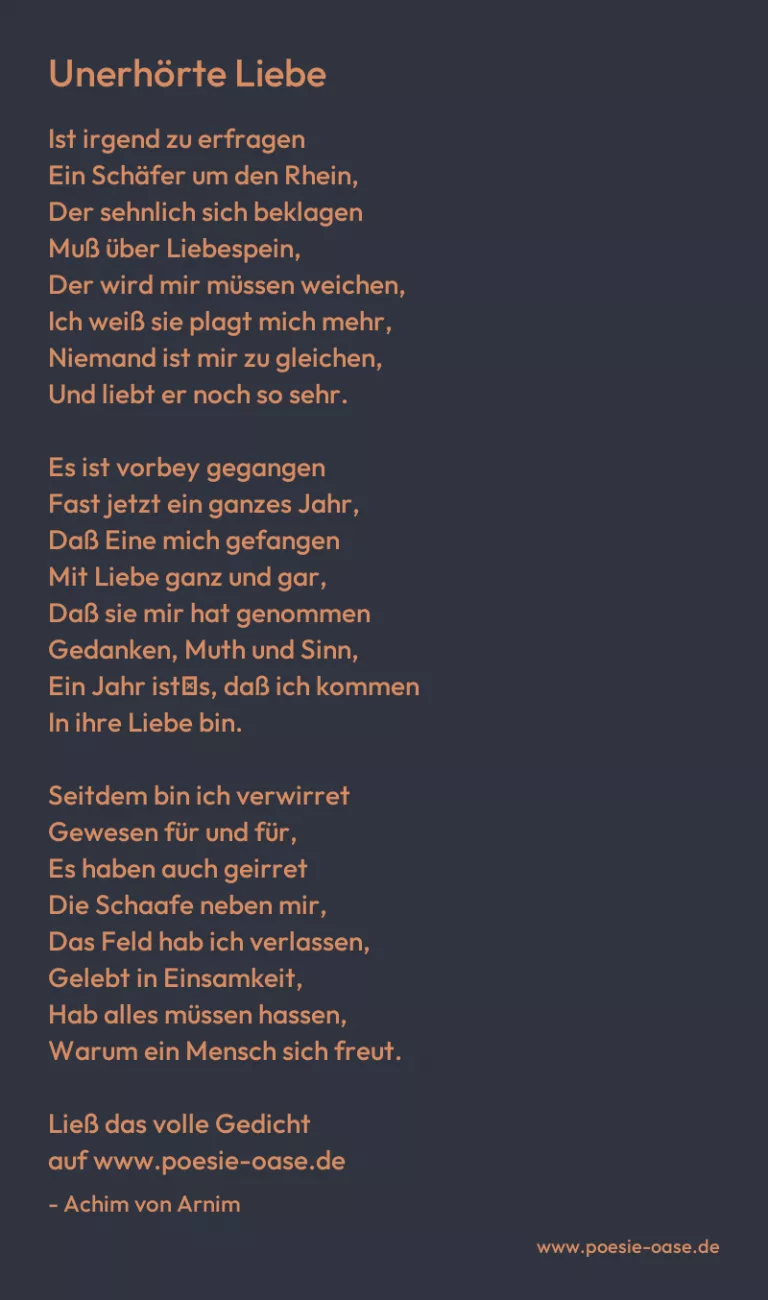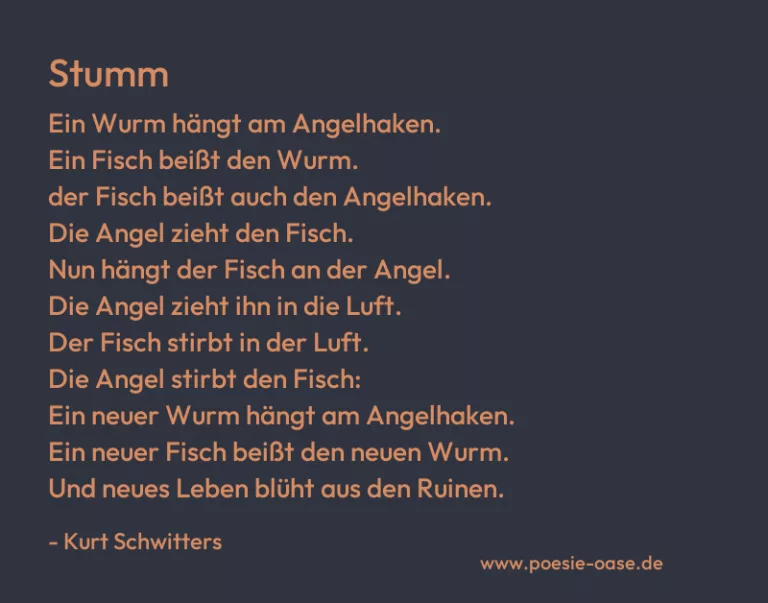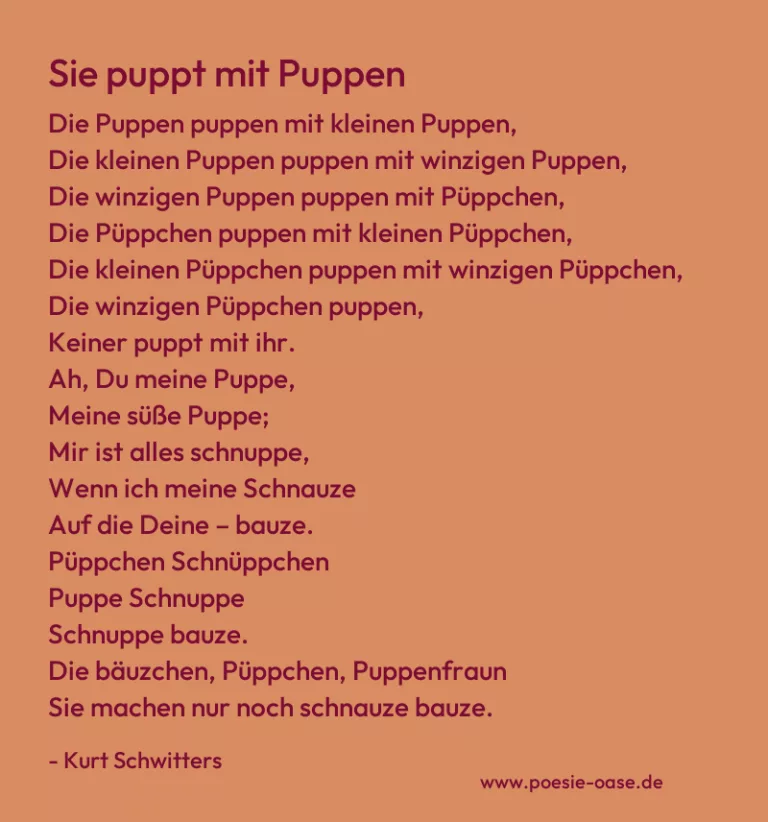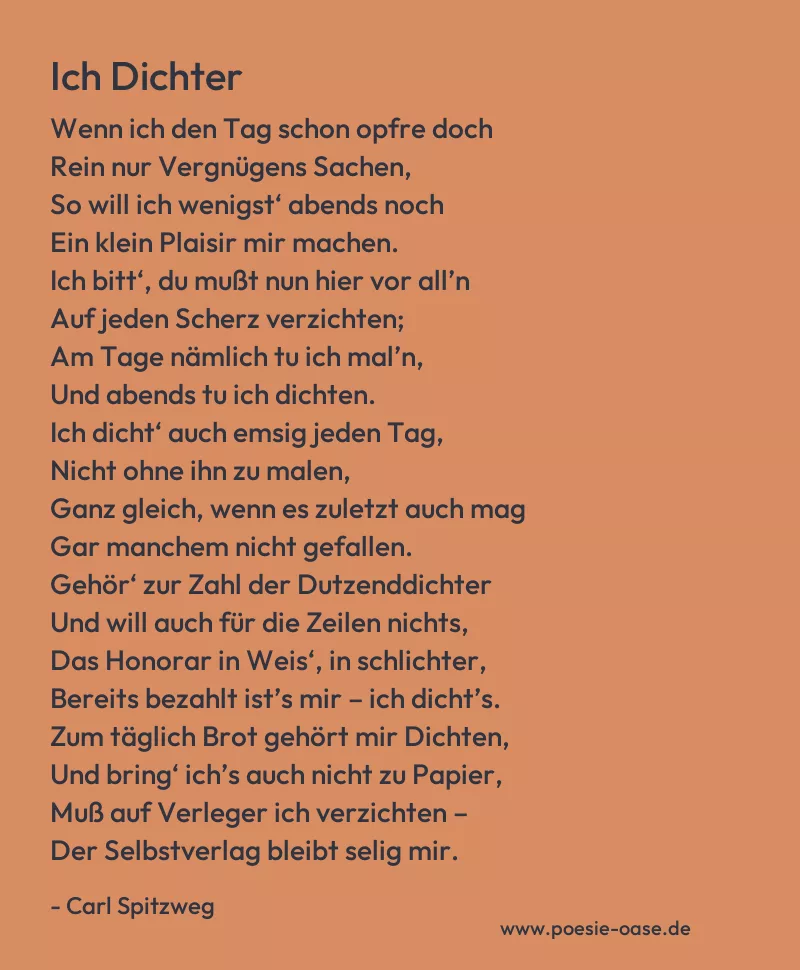Ich Dichter
Wenn ich den Tag schon opfre doch
Rein nur Vergnügens Sachen,
So will ich wenigst‘ abends noch
Ein klein Plaisir mir machen.
Ich bitt‘, du mußt nun hier vor all’n
Auf jeden Scherz verzichten;
Am Tage nämlich tu ich mal’n,
Und abends tu ich dichten.
Ich dicht‘ auch emsig jeden Tag,
Nicht ohne ihn zu malen,
Ganz gleich, wenn es zuletzt auch mag
Gar manchem nicht gefallen.
Gehör‘ zur Zahl der Dutzenddichter
Und will auch für die Zeilen nichts,
Das Honorar in Weis‘, in schlichter,
Bereits bezahlt ist’s mir – ich dicht’s.
Zum täglich Brot gehört mir Dichten,
Und bring‘ ich’s auch nicht zu Papier,
Muß auf Verleger ich verzichten –
Der Selbstverlag bleibt selig mir.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
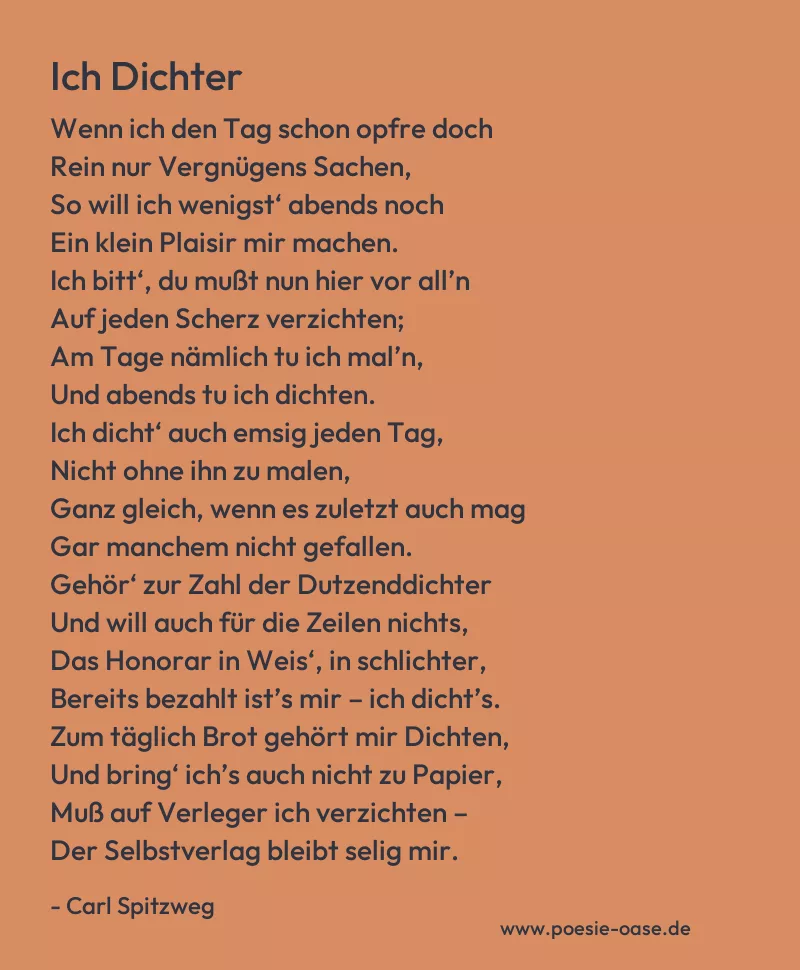
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich Dichter“ von Carl Spitzweg bietet einen humorvollen und selbstreflexiven Blick auf das Leben eines Dichters. Der Sprecher beschreibt seinen Tagesablauf, in dem er den Tag mit „Vergnügens Sachen“ verbringt, aber abends der Dichtkunst widmet. Der Gegensatz zwischen der oberflächlichen Beschäftigung am Tag und der ernsthaften Dichtung in der Abendzeit zeigt, wie der Sprecher das Schreiben als etwas betrachtet, das ihm persönlich Freude bereitet, ohne dass es von äußeren Erwartungen oder Anforderungen geprägt wird.
Der humorvolle Ton des Gedichts wird durch die Worte „ich bitt‘, du mußt nun hier vor all’n auf jeden Scherz verzichten“ deutlich, was auf die verspielte Haltung des Sprechers hinweist. Er nimmt sich selbst nicht zu ernst und sieht das Dichten als eine Art Spielerei oder persönliches Vergnügen an, das er regelmäßig ausführt – ganz gleich, wie seine Werke von anderen aufgenommen werden. Dies zeigt, dass er in seiner Dichtkunst keine äußere Bestätigung sucht.
Der Sprecher sieht sich selbst als Teil der „Zahl der Dutzenddichter“, was eine ironische Bemerkung auf die Vielzahl von Schriftstellern und Dichtern in seiner Zeit ist. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass er nicht auf Ruhm oder Anerkennung aus ist, sondern einfach als „Dichter“ in einer breiten Masse von Gleichgesinnten fungiert. Der Verzicht auf Honorar und die Erwähnung des „Selbstverlags“ unterstreichen seine Unabhängigkeit und seine Haltung, dass er sich nicht von kommerziellen Zielen oder Erwartungen leiten lässt.
Das Gedicht endet mit einer fast philosophischen Bemerkung: „Zum täglich Brot gehört mir Dichten“. Hier wird Dichten als eine unverzichtbare, tägliche Praxis dargestellt, die den Sprecher erfüllt, selbst wenn sie nicht den äußeren, gesellschaftlichen Anerkennungen entspricht. Der Sprecher ist im Selbstverlag zufrieden, was darauf hinweist, dass er die Dichtkunst als persönlichen Ausdruck und als eine Lebensweise betrachtet, die ihm mehr bedeutet als finanzieller Erfolg oder öffentliche Aufmerksamkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.