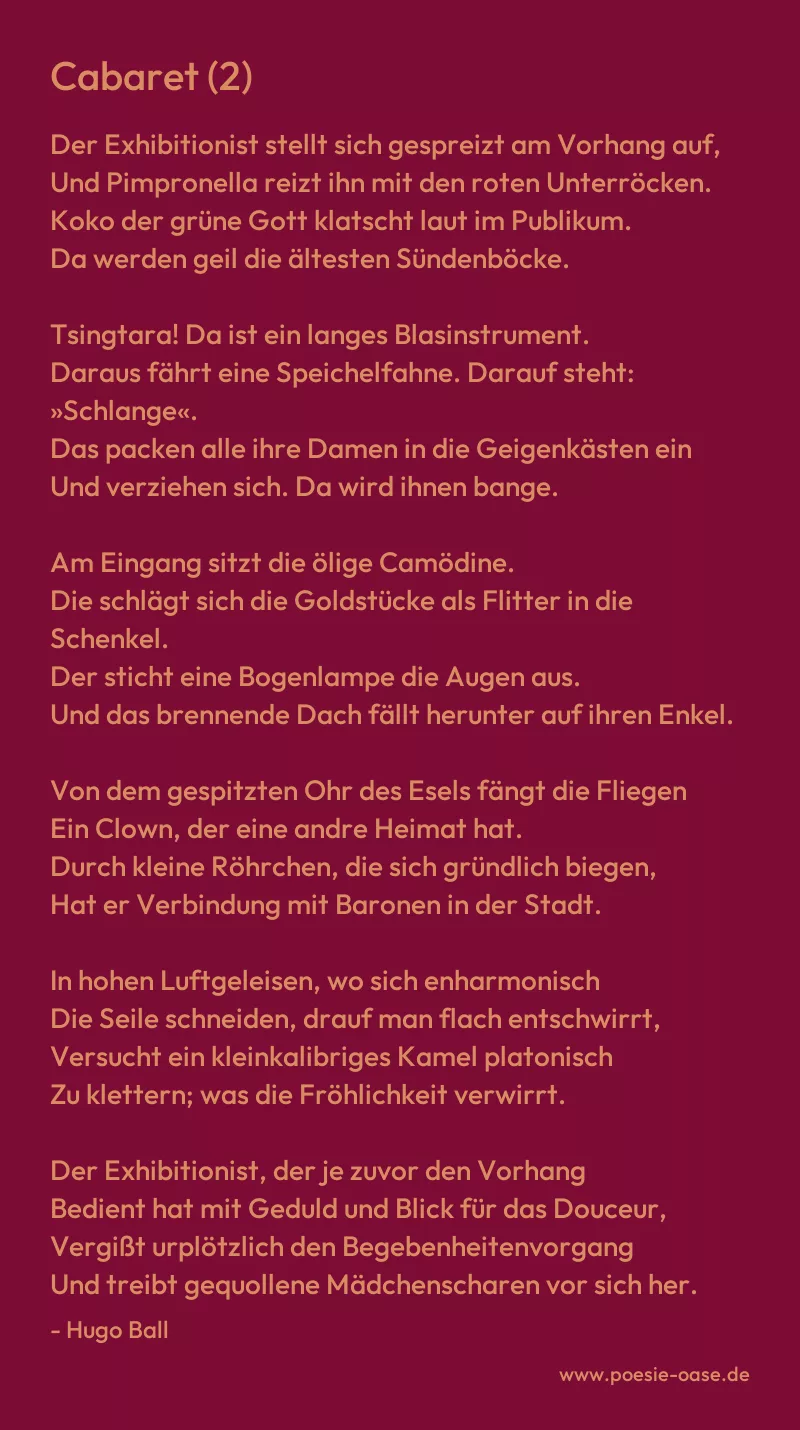Cabaret (2)
Der Exhibitionist stellt sich gespreizt am Vorhang auf,
Und Pimpronella reizt ihn mit den roten Unterröcken.
Koko der grüne Gott klatscht laut im Publikum.
Da werden geil die ältesten Sündenböcke.
Tsingtara! Da ist ein langes Blasinstrument.
Daraus fährt eine Speichelfahne. Darauf steht: »Schlange«.
Das packen alle ihre Damen in die Geigenkästen ein
Und verziehen sich. Da wird ihnen bange.
Am Eingang sitzt die ölige Camödine.
Die schlägt sich die Goldstücke als Flitter in die Schenkel.
Der sticht eine Bogenlampe die Augen aus.
Und das brennende Dach fällt herunter auf ihren Enkel.
Von dem gespitzten Ohr des Esels fängt die Fliegen
Ein Clown, der eine andre Heimat hat.
Durch kleine Röhrchen, die sich gründlich biegen,
Hat er Verbindung mit Baronen in der Stadt.
In hohen Luftgeleisen, wo sich enharmonisch
Die Seile schneiden, drauf man flach entschwirrt,
Versucht ein kleinkalibriges Kamel platonisch
Zu klettern; was die Fröhlichkeit verwirrt.
Der Exhibitionist, der je zuvor den Vorhang
Bedient hat mit Geduld und Blick für das Douceur,
Vergißt urplötzlich den Begebenheitenvorgang
Und treibt gequollene Mädchenscharen vor sich her.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
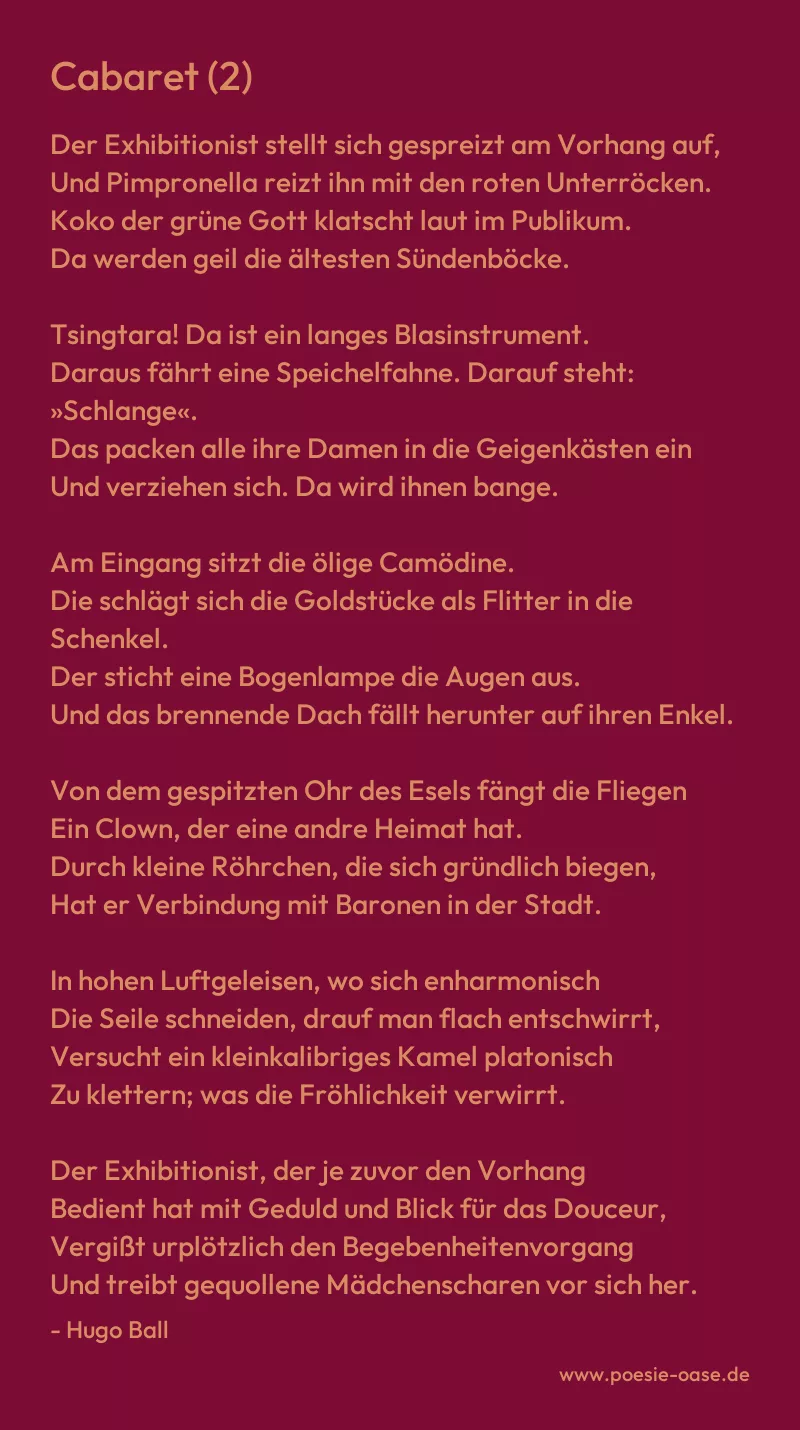
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Cabaret (2)“ von Hugo Ball ist eine avantgardistische, dadaistische Momentaufnahme einer grotesken und absurden Vorstellung in einem Cabaret. Es entwirft ein verstörendes Bild, das von Dekadenz, sexueller Anspielung, Zerstörung und Sinnlosigkeit geprägt ist. Die Sprache ist expressiv und unkonventionell, durchsetzt mit ungewöhnlichen Wortbildungen und Lautmalerei, die den Hörer bzw. Leser in eine Welt des Chaos und der Provokation eintauchen lassen soll. Ball nutzt die Form des Gedichts, um etablierte Konventionen zu untergraben und eine neue, oftmals widersprüchliche Ästhetik zu etablieren.
Das Gedicht gliedert sich in sechs Strophen, die jeweils eine Szene oder ein kurzes Bild aus der Cabaret-Welt präsentieren. Der „Exhibitionist“ und „Pimpronella“ (offenbar eine Tänzerin) eröffnen die Vorstellung, wobei die sexuelle Konnotation sofort erkennbar ist. Koko, eine grüne Gottheit, die im Publikum applaudiert, deutet auf eine Verflachung des Kultes und die Verdrehung traditioneller Werte hin. Die „ältesten Sündenböcke“ verweisen auf eine Gesellschaft, die sich in ihren Lastern suhlt. Die zweite Strophe mit „Tsingtara“ und der „Schlange“ spielt mit einem komplexen Symbolismus und unterbricht abrupt die heitere Stimmung, indem sie Angst und Unbehagen weckt.
Die folgenden Strophen setzen diesen Trend fort. Die „Camödine“ (vermutlich eine Figur, die mit Geld und Eitelkeit zu tun hat) wird dargestellt, während eine „Bogenlampe“ ihre Augen „aussticht“, was auf eine mögliche Zerstörung des Sehvermögens oder der Wahrnehmung hindeutet. Der Clown, der „eine andre Heimat hat“ und mit Baronen kommuniziert, deutet auf eine Verbindung zwischen der absurden Welt des Cabarets und der etablierten Gesellschaft hin. Das Kamel, das versucht, „platonisch“ zu klettern, steht für das Scheitern von Idealen und die Absurdität von Bestrebungen.
Die letzte Strophe bringt das Gedicht zu einem düsteren Abschluss. Der Exhibitionist, der zuvor dem „Douceur“ (der Anmut) des Vorhangs verpflichtet war, vergisst plötzlich alles und treibt stattdessen „gequollene Mädchenscharen“ vor sich her, was auf eine Eskalation der Obszönität und des Kontrollverlusts hindeutet. Das Gedicht endet damit, dass die ursprüngliche Ordnung zerstört wird und die dekadente Welt des Cabarets, die bereits durch Gewalt und Verfall gekennzeichnet war, ihre ganze Hässlichkeit offenbart. Balls Gedicht ist ein radikaler Kommentar zur moralischen und künstlerischen Krise seiner Zeit, ein Zeugnis für die Zerstörung der Werte und der Sinnlosigkeit des Lebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.