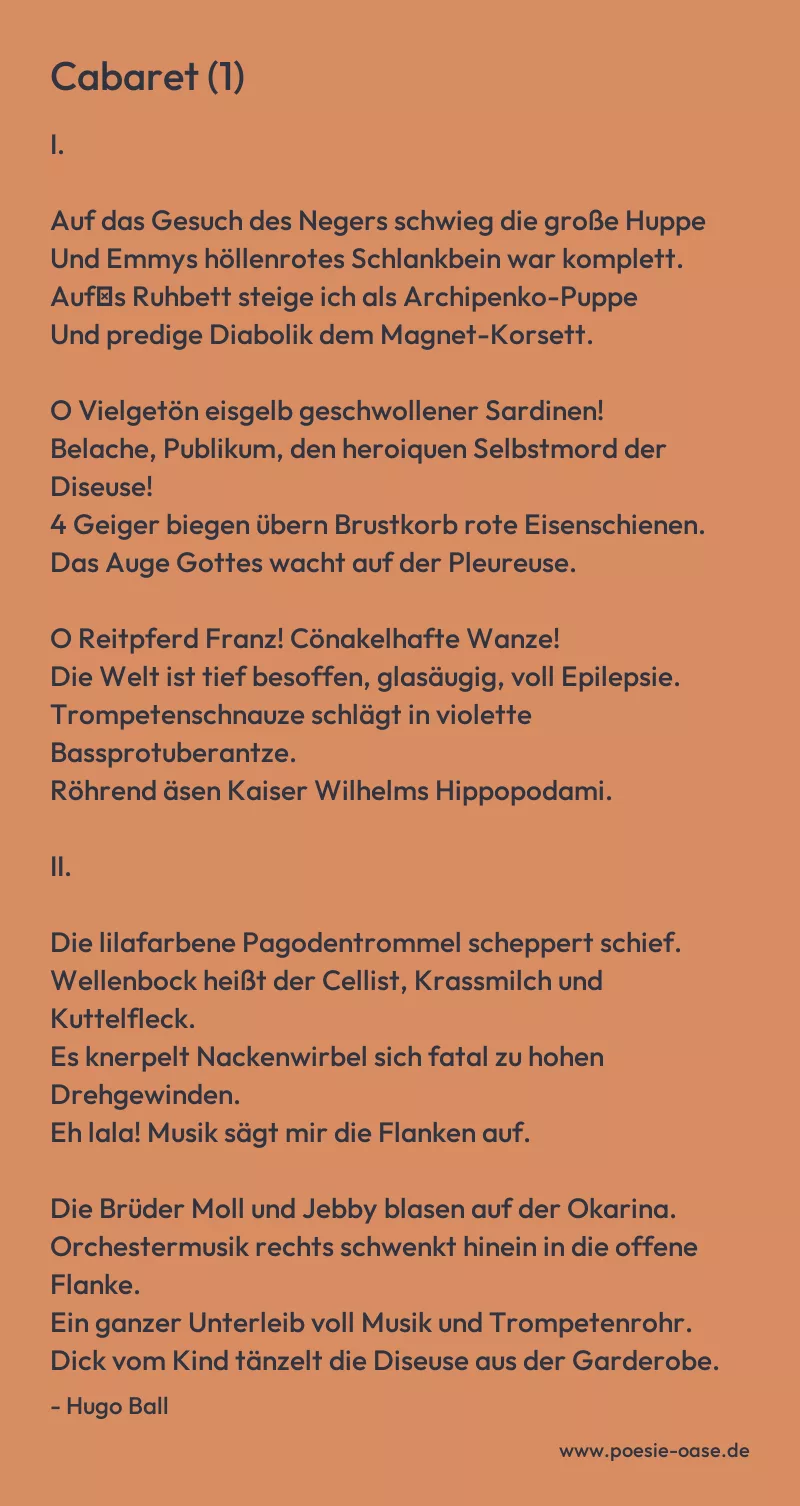Cabaret (1)
I.
Auf das Gesuch des Negers schwieg die große Huppe
Und Emmys höllenrotes Schlankbein war komplett.
Auf′s Ruhbett steige ich als Archipenko-Puppe
Und predige Diabolik dem Magnet-Korsett.
O Vielgetön eisgelb geschwollener Sardinen!
Belache, Publikum, den heroiquen Selbstmord der Diseuse!
4 Geiger biegen übern Brustkorb rote Eisenschienen.
Das Auge Gottes wacht auf der Pleureuse.
O Reitpferd Franz! Cönakelhafte Wanze!
Die Welt ist tief besoffen, glasäugig, voll Epilepsie.
Trompetenschnauze schlägt in violette Bassprotuberantze.
Röhrend äsen Kaiser Wilhelms Hippopodami.
II.
Die lilafarbene Pagodentrommel scheppert schief.
Wellenbock heißt der Cellist, Krassmilch und Kuttelfleck.
Es knerpelt Nackenwirbel sich fatal zu hohen Drehgewinden.
Eh lala! Musik sägt mir die Flanken auf.
Die Brüder Moll und Jebby blasen auf der Okarina.
Orchestermusik rechts schwenkt hinein in die offene Flanke.
Ein ganzer Unterleib voll Musik und Trompetenrohr.
Dick vom Kind tänzelt die Diseuse aus der Garderobe.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
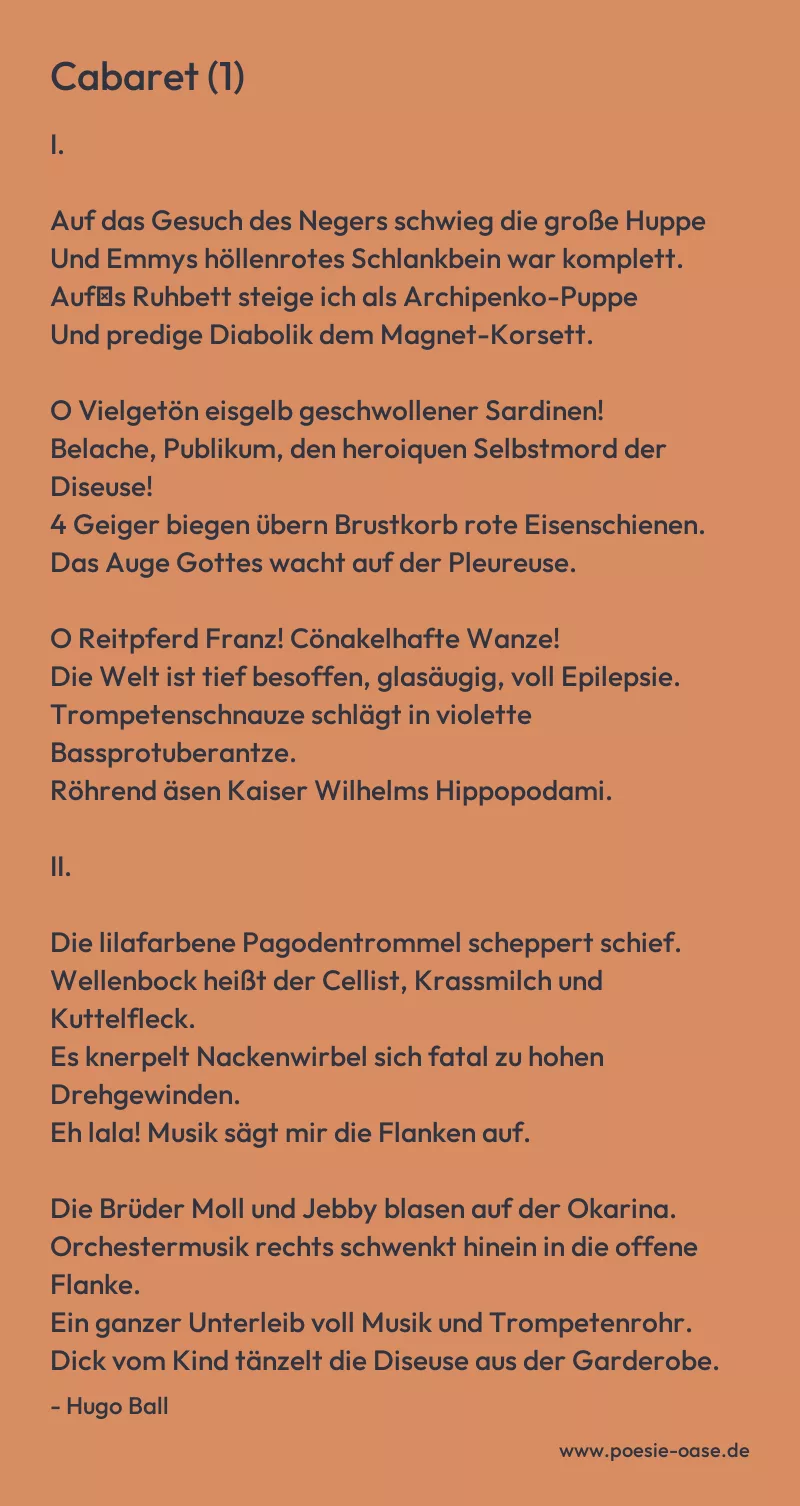
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Cabaret (1)“ von Hugo Ball ist eine avantgardistische Auseinandersetzung mit dem Cabaret-Genre, der Dekadenz und der Zerrissenheit der modernen Welt. Es ist kein traditionelles Gedicht, sondern vielmehr eine eklektische Collage von Bildern, Lauten und fragmentierten Gedanken, die zusammen ein vielschichtiges und verstörendes Gesamtbild ergeben. Die Verwendung von Dada-Elementen, wie nonsenshaften Worten, Lautmalerei und der Zerstörung konventioneller Syntax, spiegelt Balls Ablehnung der bürgerlichen Kultur und seine Suche nach neuen Formen des Ausdrucks wider.
Der erste Teil des Gedichts eröffnet mit einer Reihe von skurrilen und surrealen Bildern. Die „große Huppe“, das „höllenrote Schlankbein“ und die „Archipenko-Puppe“ erzeugen eine Atmosphäre der Verfremdung und des Obszönen. Die „Diabolik“ des „Magnet-Korsett“ deutet auf eine Verbindung von Erotik, Verführung und Zerstörung hin. Der Appell an das Publikum, den „heroiquen Selbstmord der Diseuse“ zu belachen, bricht mit den konventionellen Erwartungen und betont die Sinnlosigkeit und Absurdität der dargestellten Welt. Die „roten Eisenschienen“ der Geiger und das „Auge Gottes“ auf der „Pleureuse“ (Puppe?) verstärken diese Atmosphäre. Der Bezug auf Kaiser Wilhelm und „Hippopodami“ verweist auf die politische und gesellschaftliche Situation der Zeit, die Ball als korrupt und krankhaft empfand.
Der zweite Teil des Gedichts setzt diese Zerrissenheit fort. Die „lilafarbene Pagodentrommel“, der „Wellenbock“-Cellist und die „hohen Drehgewinden“ erzeugen ein Gefühl der Unruhe und des Chaos. Die Musik, die „die Flanken auf“ sägt, wird als gewalttätig und zerstörerisch dargestellt. Die Verwendung von musikalischen Begriffen wie „Moll“ und „Okarina“ unterstreicht die Verbindung zur musikalischen Welt des Cabarets, während die fragmentierte Sprache und die surrealen Bilder die konventionellen Erwartungen an diese Welt untergraben. Die „Diseuse“, die aus der Garderobe tanzt, scheint wie ein Produkt der kranken Welt.
Insgesamt ist „Cabaret (1)“ ein provokantes und vieldeutiges Gedicht, das die Auflösung von Traditionen und die Zerrissenheit der modernen Welt widerspiegelt. Ball nutzt die Elemente des Cabarets, um eine Welt des Wahnsinns, der Dekadenz und der Sinnlosigkeit zu schaffen. Das Gedicht ist kein leicht verständliches Werk, sondern eine Herausforderung an den Leser, sich auf die fragmentierten Bilder, die ungewöhnliche Sprache und die Absurdität einzulassen, um die tiefere Bedeutung hinter der Oberfläche zu erkennen. Es ist ein Manifest des Dadaismus, das die etablierten Normen der Kunst und Gesellschaft in Frage stellt und eine neue Form des Ausdrucks sucht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.