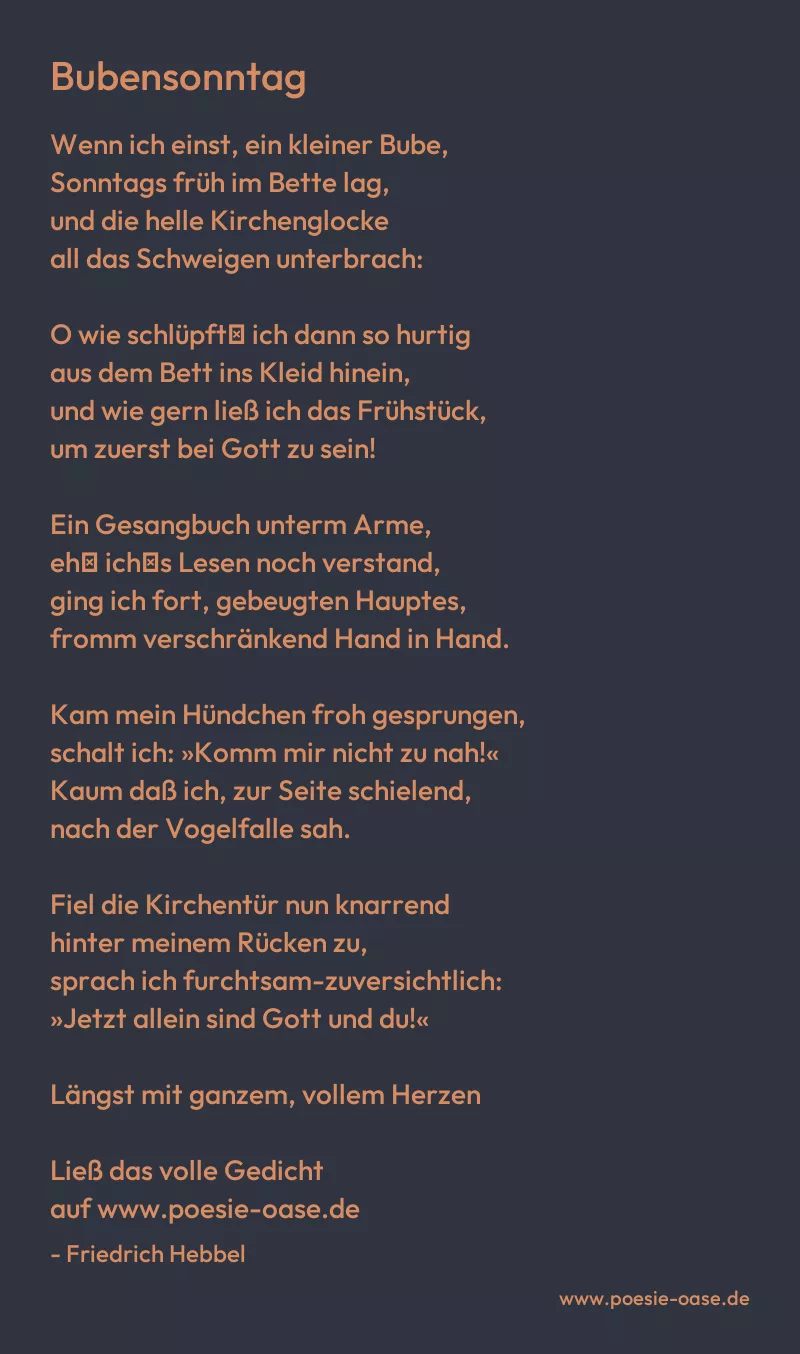Wenn ich einst, ein kleiner Bube,
Sonntags früh im Bette lag,
und die helle Kirchenglocke
all das Schweigen unterbrach:
O wie schlüpft′ ich dann so hurtig
aus dem Bett ins Kleid hinein,
und wie gern ließ ich das Frühstück,
um zuerst bei Gott zu sein!
Ein Gesangbuch unterm Arme,
eh′ ich′s Lesen noch verstand,
ging ich fort, gebeugten Hauptes,
fromm verschränkend Hand in Hand.
Kam mein Hündchen froh gesprungen,
schalt ich: »Komm mir nicht zu nah!«
Kaum daß ich, zur Seite schielend,
nach der Vogelfalle sah.
Fiel die Kirchentür nun knarrend
hinter meinem Rücken zu,
sprach ich furchtsam-zuversichtlich:
»Jetzt allein sind Gott und du!«
Längst mit ganzem, vollem Herzen
hing ich da an meinem Gott,
Doch, daß niemand ihn erblicke,
hielt ich stets für eitel Spott.
Und so hofft′ ich jeden Morgen,
endlich einmal ihn zu seh′n;
war′s denn nichts in meinen Jahren,
stets um fünfe aufzustehn?
Auf dem hohen Turm die Glocke
war schon lange wieder stumm,
der Altar warf düstre Schatten,
Gräber lagen rings herum.
Drang ein Schall zu mir herüber,
dacht′ ich: jetzt wirst du ihn schaun!
Aber meine Augen schlossen
sich zugleich vor Angst und Graun.
Und dies Zittern, dies Erbangen
und mein kalter Todesschweiß –
daß der Herr vorbeigewandelt,
galt mir alles für Beweis.
Still und träumend dann zu Hause
schlich ich mich in süßer Qual,
und mein klopfend Herz gelobte,
sich mehr Mut fürs nächste Mal.