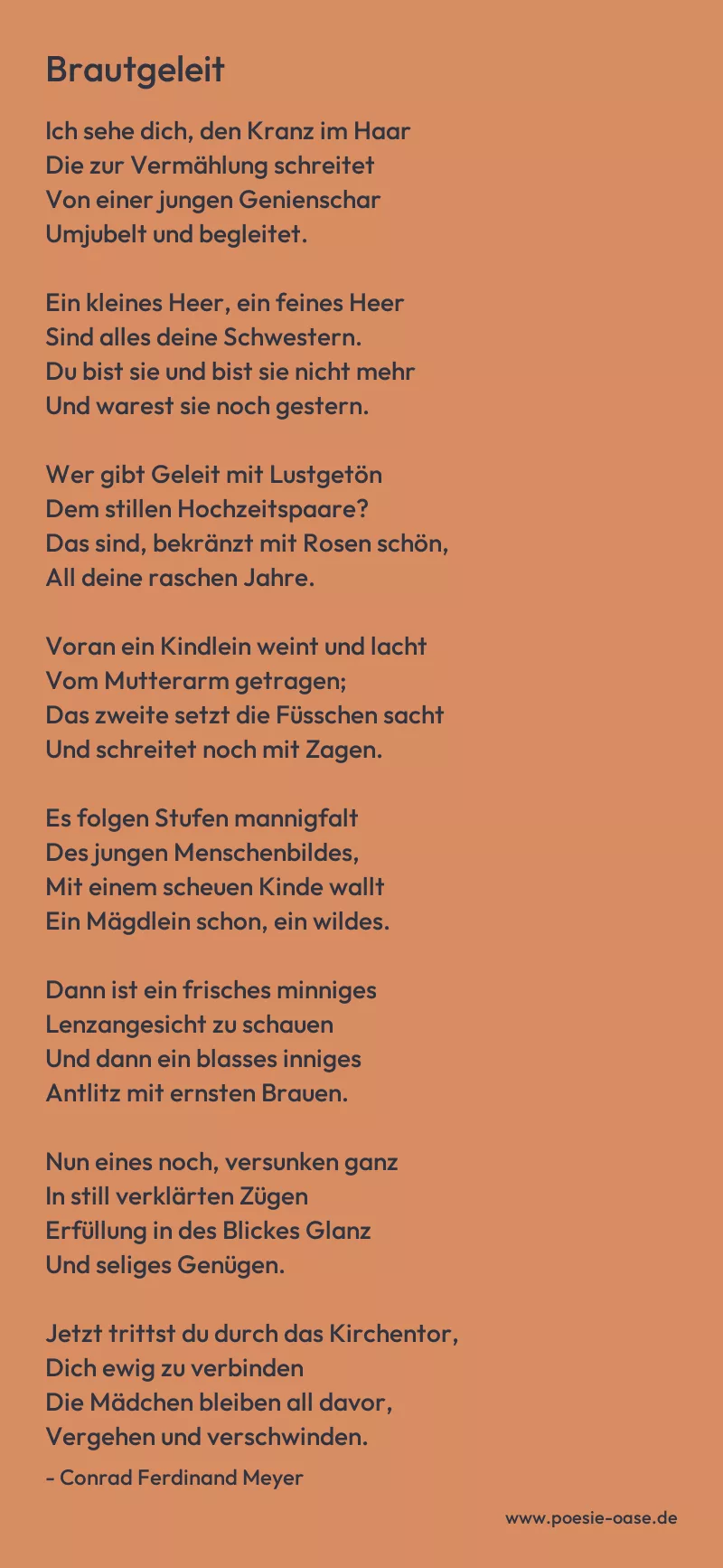Brautgeleit
Ich sehe dich, den Kranz im Haar
Die zur Vermählung schreitet
Von einer jungen Genienschar
Umjubelt und begleitet.
Ein kleines Heer, ein feines Heer
Sind alles deine Schwestern.
Du bist sie und bist sie nicht mehr
Und warest sie noch gestern.
Wer gibt Geleit mit Lustgetön
Dem stillen Hochzeitspaare?
Das sind, bekränzt mit Rosen schön,
All deine raschen Jahre.
Voran ein Kindlein weint und lacht
Vom Mutterarm getragen;
Das zweite setzt die Füsschen sacht
Und schreitet noch mit Zagen.
Es folgen Stufen mannigfalt
Des jungen Menschenbildes,
Mit einem scheuen Kinde wallt
Ein Mägdlein schon, ein wildes.
Dann ist ein frisches minniges
Lenzangesicht zu schauen
Und dann ein blasses inniges
Antlitz mit ernsten Brauen.
Nun eines noch, versunken ganz
In still verklärten Zügen
Erfüllung in des Blickes Glanz
Und seliges Genügen.
Jetzt trittst du durch das Kirchentor,
Dich ewig zu verbinden
Die Mädchen bleiben all davor,
Vergehen und verschwinden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
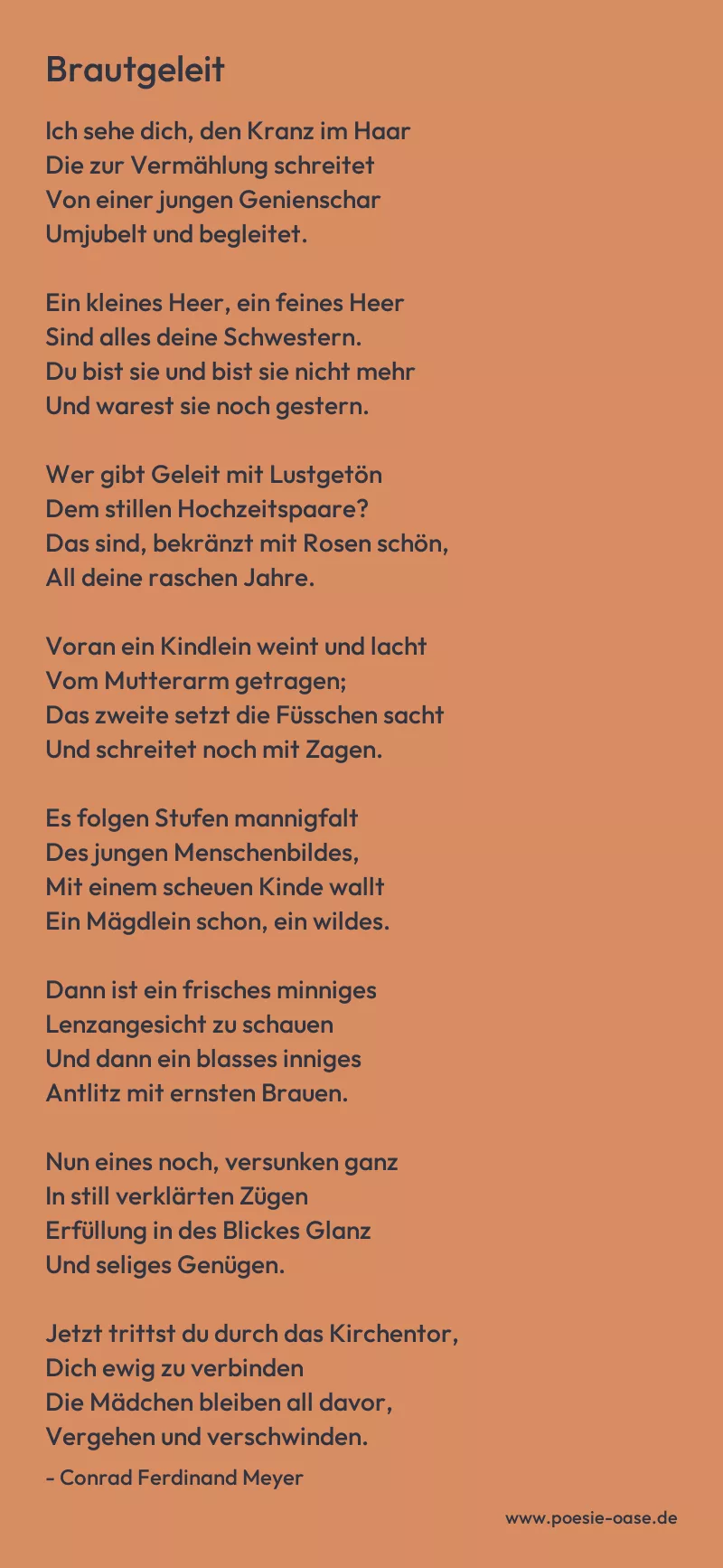
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Brautgeleit“ von Conrad Ferdinand Meyer ist eine Metapher für den Übergang einer Frau in den Ehestand und die damit verbundene Vergänglichkeit der Jugend. Es beschreibt einen imaginären Festzug, der die Braut zu ihrer Hochzeit begleitet, wobei die „Genienschar“ aus ihren jungen Jahren und den verschiedenen Stadien ihres bisherigen Lebens besteht. Das Gedicht ist in sieben Strophen unterteilt, die jeweils eine Phase dieses „Geleits“ darstellen und somit die verschiedenen Entwicklungsstufen der Braut symbolisieren.
In den ersten beiden Strophen wird das Bild der Braut und ihrer Begleiterinnen, den Schwestern, etabliert. Die Schwesternschaft steht für die Gemeinschaft der Jugend und die Einheit der Vergangenheit. Der Satz „Du bist sie und bist sie nicht mehr / Und warest sie noch gestern“ verdeutlicht den Wandel, der mit der Heirat einhergeht: Die Braut verlässt die Gemeinschaft der unverheirateten jungen Frauen und tritt in eine neue Lebensphase ein. In den folgenden Strophen wird dieser Wandel durch die verschiedenen Gestalten und Charaktere der Begleiterinnen veranschaulicht, die von fröhlichen Kindheitserinnerungen bis hin zu erwachsenen, reifen Erfahrungen reichen.
Die dritte bis sechste Strophe widmen sich der Entfaltung dieser Lebensstadien. „All deine raschen Jahre“ werden personifiziert und mit Rosen geschmückt, was die Schönheit und Vergänglichkeit der Jugend betont. Ein „Kindlein“, das „weint und lacht“, symbolisiert die Unbeschwertheit der Kindheit, während das „Mägdlein“, „wild“ und „minnig“, die aufkeimende Jugend und die ersten Erfahrungen mit Liebe und Leidenschaft verkörpert. Die verschiedenen Gesichter spiegeln die inneren und äußeren Veränderungen wider, die eine Frau im Laufe ihres Lebens durchmacht. Das blasse, innige Antlitz mit ernsten Brauen deutet auf die Reife und die Erfahrungen der Erwachsenenzeit hin.
Die letzte Strophe markiert den Höhepunkt und das Ende des „Brautgeleits“. Die Braut tritt durch das Kirchentor, um sich „ewig zu verbinden“, während die Mädchen, die ihre vergangenen Ichs repräsentieren, draußen bleiben und „vergehen und verschwinden“. Dies unterstreicht die endgültige Trennung von der Vergangenheit und den Eintritt in die neue Lebensphase der Ehe. Die Verse vermitteln eine Mischung aus Nostalgie, Abschied und der Akzeptanz des Lebenskreislaufs, in dem jede Phase ihre Zeit hat und letztendlich der Vergänglichkeit unterliegt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.