Ich habe mich bedacht, daß schönste Tage
Nur jene heißen dürfen, da wir redend
Die Landschaft uns vor Augen in ein Reich
Der Seele wandelten: da hügelan
Dem Schatten zu wir stiegen in den Hain,
Der uns umfing wie schon einmal Erlebtes,
Da wir auf abgetrennten Wiesen still
Den Traum vorn Leben niegeahnter Wesen,
Ja ihres Gehns und Trinkens Spuren fanden
Und überm Teich ein gleitendes Gespräch,
Noch tiefere Wölbung spiegelnd als der Himmel:
Ich habe mich bedacht auf solche Tage,
Und daß nächst diesen drei: gesund zu sein.
Am eignen Leib und Leben sich zu freuen.
Und an Gedanken, Flügeln junger Adler,
Nur eines frommt: gesellig sein mit Freunden.
So will ich, daß du kommst und mit mir trinkst
Aus jenen Krügen, die mein Erbe sind,
Geschmückt mit Laubwerk und beschwingten Kindern,
Und mit mir sitzest in dem Garten-Turm:
Zwei Jünglinge bewachen seine Tür,
In deren Köpfen mit gedämpftem Blick
Halbabgewandt ein ungeheures
Geschick dich steinern anschaut, daß du schweigst
Und meine Landschaft hingebreitet siehst:
Daß dann vielleicht ein Vers von dir sie mir
Veredelt künftig in der Einsamkeit
Und da und dort Erinnerung an dich
Im Schatten nistet und zur Dämmerung
Die Straße zwischen dunklen Wipfeln rollt
Und schattenlose Wege in der Luft
Dahinrolln wie ein feiner goldner Donner.
Botschaft
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
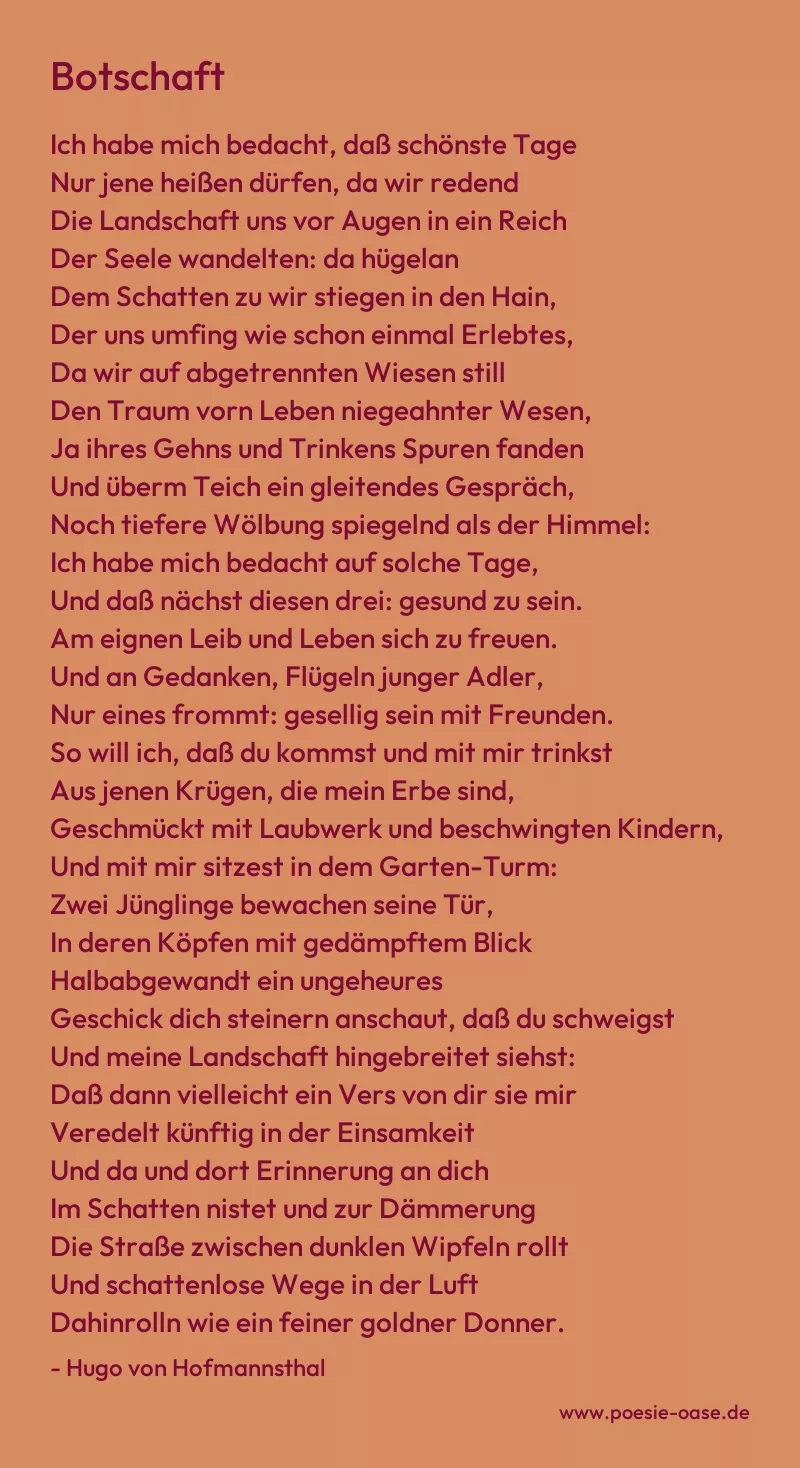
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Botschaft“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine feierliche Einladung, die von einer tiefen Sehnsucht nach Verbundenheit, Schönheit und dem Erleben von intensiven Momenten getragen wird. Es beginnt mit der Reflexion über „schönste Tage“, die sich durch gemeinsame Gespräche und die harmonische Wahrnehmung der Natur auszeichnen. Diese Tage, in denen die Landschaft durch das Reden in ein „Reich der Seele“ verwandelt wird, bilden das Ideal, nach dem sich der Dichter sehnt. Die Erinnerung an diese Momente, in denen das Leben in seiner ganzen Fülle erlebt wird, dominiert das Gedicht und dient als Grundlage für die Botschaft des Autors.
Die anschließende Aufzählung von Prioritäten – „gesund zu sein“, „am eignen Leib und Leben sich zu freuen“ und „gesellig sein mit Freunden“ – unterstreicht die Bedeutung des gegenwärtigen Glücks und der sozialen Beziehungen. Diese Werte werden als wesentlich erachtet, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Der Dichter verbindet diese Lebensphilosophie mit der konkreten Einladung an den Adressaten des Gedichts, an einem gemeinsamen Erleben teilzuhaben. Das Treffen soll in einem Garten-Turm stattfinden, einem Ort, der durch seine besondere Atmosphäre und die symbolische Bewachung durch zwei Jünglinge eine gewisse Aura der Geheimnis und Erwartung aufbaut.
Die Beschreibung des Garten-Turms und der Szenerie, die sich dem Betrachter bietet, offenbart eine tiefe Wertschätzung für Kunst und Ästhetik. Die „Landschaft“ wird als zentrales Element präsentiert, das durch die gemeinsame Betrachtung und durch das poetische Schaffen des Adressaten veredelt werden soll. Die „steinernen“ Wächter, die „Halbabgewandt“ ein „ungeheures Geschick“ in ihren Köpfen bergen, deuten auf die Vergänglichkeit des Lebens und die Notwendigkeit, die kostbaren Momente zu schätzen. Das Gedicht verspricht, dass die gemeinsame Erfahrung die Einsamkeit des Dichters mildern und bleibende Erinnerungen schaffen wird.
Die abschließenden Zeilen malen ein stimmungsvolles Bild der Nachwirkung des Zusammentreffens. Die Erinnerung an den Freund soll im Schatten „nisten“ und die „Straße zwischen dunklen Wipfeln“ in der Dämmerung rollen. Dies symbolisiert die anhaltende Präsenz des Freundes und die transformative Kraft der gemeinsamen Erfahrung. Der „feine goldne Donner“ deutet auf eine subtile, aber wirkungsvolle Veränderung, die durch die geteilten Erlebnisse und die daraus resultierende innere Bereicherung entsteht. Das Gedicht ist somit eine Feier der Freundschaft, der Kunst und des Bewusstseins für die Schönheit des Lebens.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
