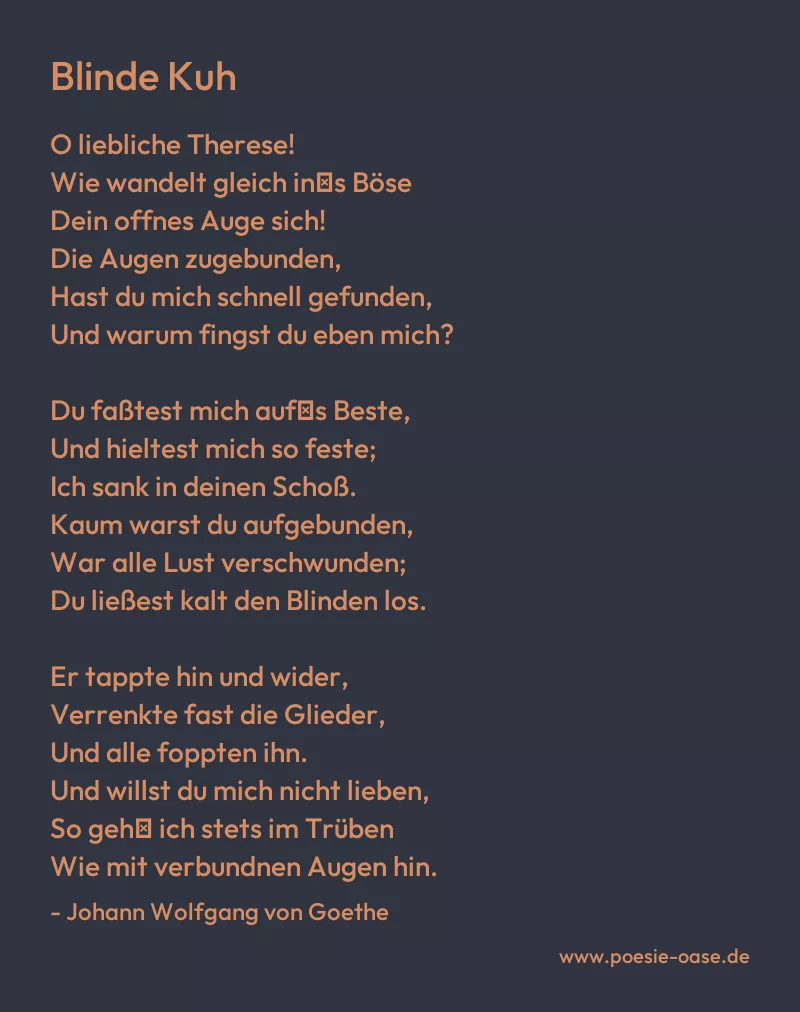Blinde Kuh
O liebliche Therese!
Wie wandelt gleich in′s Böse
Dein offnes Auge sich!
Die Augen zugebunden,
Hast du mich schnell gefunden,
Und warum fingst du eben mich?
Du faßtest mich auf′s Beste,
Und hieltest mich so feste;
Ich sank in deinen Schoß.
Kaum warst du aufgebunden,
War alle Lust verschwunden;
Du ließest kalt den Blinden los.
Er tappte hin und wider,
Verrenkte fast die Glieder,
Und alle foppten ihn.
Und willst du mich nicht lieben,
So geh′ ich stets im Trüben
Wie mit verbundnen Augen hin.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
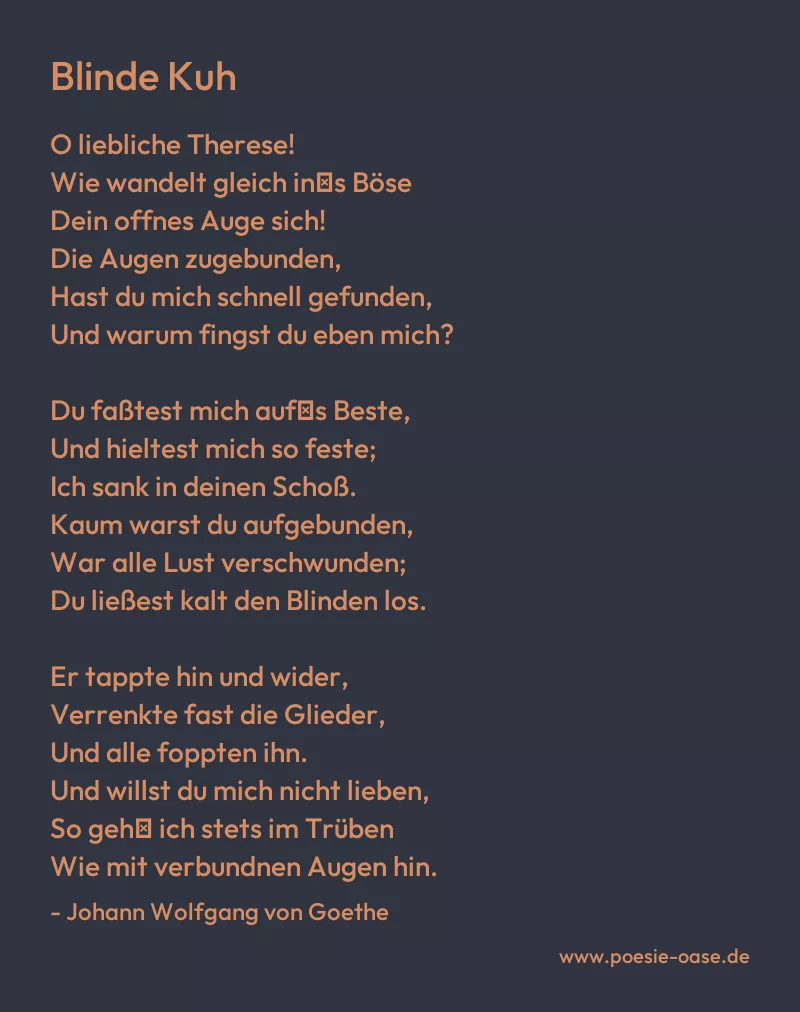
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Blinde Kuh“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine humorvolle und zugleich melancholische Reflexion über die Enttäuschung und das Ende der Liebe. Es bedient sich der spielerischen Metapher des Kinderspiels „Blinde Kuh“, um die emotionalen Höhen und Tiefen einer Beziehung darzustellen. Das Gedicht beginnt mit einer Anrede an „liebliche Therese!“, die direkt die zentrale Figur und Adressatin des Gedichts etabliert. Der erste Vers deutet bereits eine Veränderung an, ein „Wandeln ins Böse“, welches das naive und unschuldige Spiel in eine bittersüße Auseinandersetzung verwandelt.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt die spielerische Verführung. Die „Augen zugebunden“, die Blindheit, symbolisiert hier die anfängliche Unwissenheit und die spielerische Hingabe an das Spiel. Die „Therese“ findet den Sprecher, hält ihn fest und die Beschreibung „Ich sank in deinen Schoß“ impliziert ein Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens. Das Spiel und die damit verbundenen Emotionen erreichen ihren Höhepunkt. Die anschließende Zeile „Kaum warst du aufgebunden, war alle Lust verschwunden“ offenbart jedoch abrupt das Ende der Illusion. Die Aufdeckung der Augen, die Enthüllung, beendet das Spiel und die damit verbundene Zuneigung. Die anfängliche Freude weicht der Ernüchterung.
Der zweite Teil des Gedichts zeichnet ein Bild der Verlassenheit und des Verlusts. Der Sprecher, der nun blind ist, irrt umher, verrenkt fast die Glieder und wird von anderen verspottet. Diese Szene der orientierungslosen Suche spiegelt die Verwirrung und das Leid wider, das durch die Trennung verursacht wird. Der Ausdruck „Und alle foppten ihn“ betont die Isolation und die Einsamkeit, die der Sprecher nun erfährt.
Der letzte Teil des Gedichts verbindet die Metapher des Spiels mit einer tiefen, persönlichen Erkenntnis über die Liebe und die Enttäuschung. Der Sprecher drückt den Wunsch nach Liebe aus und droht, „stets im Trüben“ zu leben, wenn ihm die Liebe verwehrt bleibt. Der Vergleich mit „verbundenen Augen“ kehrt zurück und verknüpft die ursprüngliche spielerische Blindheit mit der emotionalen Blindheit, die durch Liebeskummer verursacht wird. Das Gedicht endet mit einem tiefen Gefühl der Melancholie und der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, die durch die Enttäuschung verloren gegangen sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.