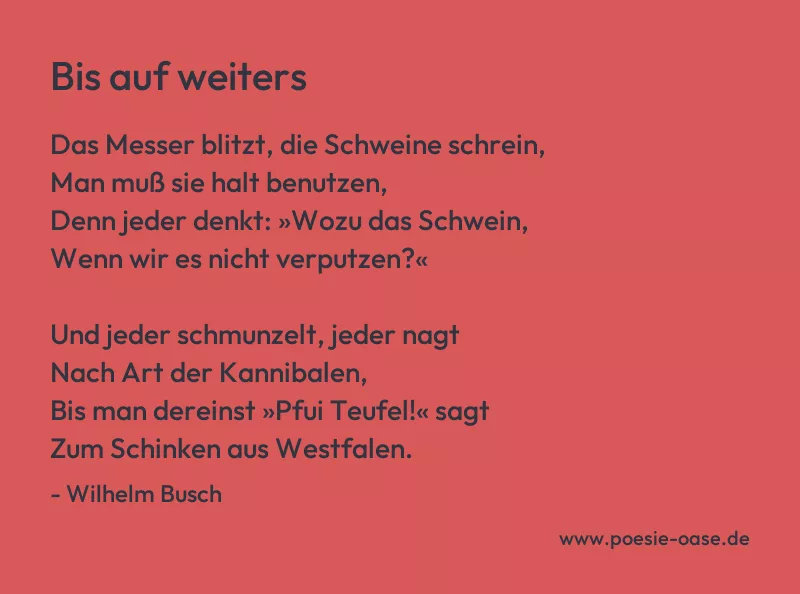Bis auf weiters
Das Messer blitzt, die Schweine schrein,
Man muß sie halt benutzen,
Denn jeder denkt: »Wozu das Schwein,
Wenn wir es nicht verputzen?«
Und jeder schmunzelt, jeder nagt
Nach Art der Kannibalen,
Bis man dereinst »Pfui Teufel!« sagt
Zum Schinken aus Westfalen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
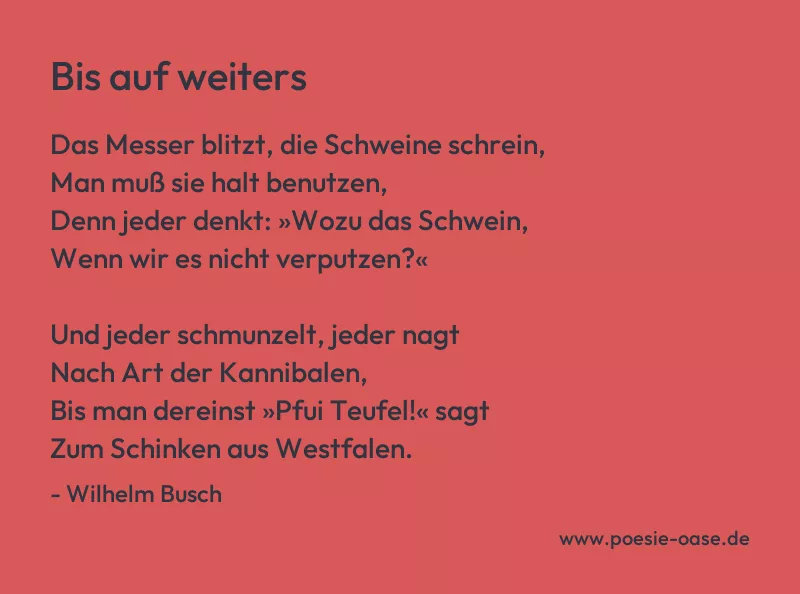
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bis auf weiters“ von Wilhelm Busch ist eine satirische Betrachtung über die kurzsichtige Ausbeutung von Ressourcen und die daraus resultierenden Konsequenzen. Es beginnt mit einer drastischen Szene, in der das Schlachten der Schweine beschrieben wird, was durch die Bilder des blitzenden Messers und des schreienden Schweins eine gewisse Härte und Unmittelbarkeit erzeugt. Diese Eröffnung dient als Metapher für das bedenkenlose Ausnutzen von Dingen und Lebewesen ohne Rücksicht auf langfristige Folgen.
Der zweite Teil des Gedichts legt den Fokus auf die Konsumenten, die „nach Art der Kannibalen“ das Fleisch verzehren. Dieser Vergleich verstärkt die Kritik an der Maßlosigkeit und der fehlenden ethischen Reflexion. Jeder Einzelne denkt nur an seinen unmittelbaren Vorteil, ohne die Gesamtwirkung zu bedenken. Das Schmunzeln und Nagen verdeutlichen die Genusssucht und die Unbekümmertheit der Menschen, die sich dem Konsum hingeben, ohne über die Herkunft und die Folgen nachzudenken.
Die Pointe des Gedichts liegt in den letzten beiden Zeilen, die einen Perspektivwechsel einleiten. Die scheinbar unschuldige Freude am Essen wird plötzlich durch ein „Pfui Teufel!“ konterkariert. Dieser Ausruf deutet auf Ekel und Ablehnung hin, was die kurzsichtige Genusssucht als etwas Verwerfliches entlarvt. Interessanterweise wird hierbei der Schinken aus Westfalen als Gegenstand des Ekels genannt, was eine spezifische Kritik an der Massenproduktion und dem möglicherweise nachlassenden Qualitätsanspruch implizieren könnte.
Busch verbindet in diesem Gedicht auf meisterhafte Weise die Elemente der Satire mit einer moralischen Botschaft. Er prangert die Gier, die Kurzatmigkeit und die mangelnde Nachhaltigkeit an, indem er die Leser mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Sprache und Bildsprache konfrontiert. Das Gedicht ist eine Warnung vor den Folgen des übermäßigen Konsums und eine Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Gewohnheiten und der Welt um uns herum.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.