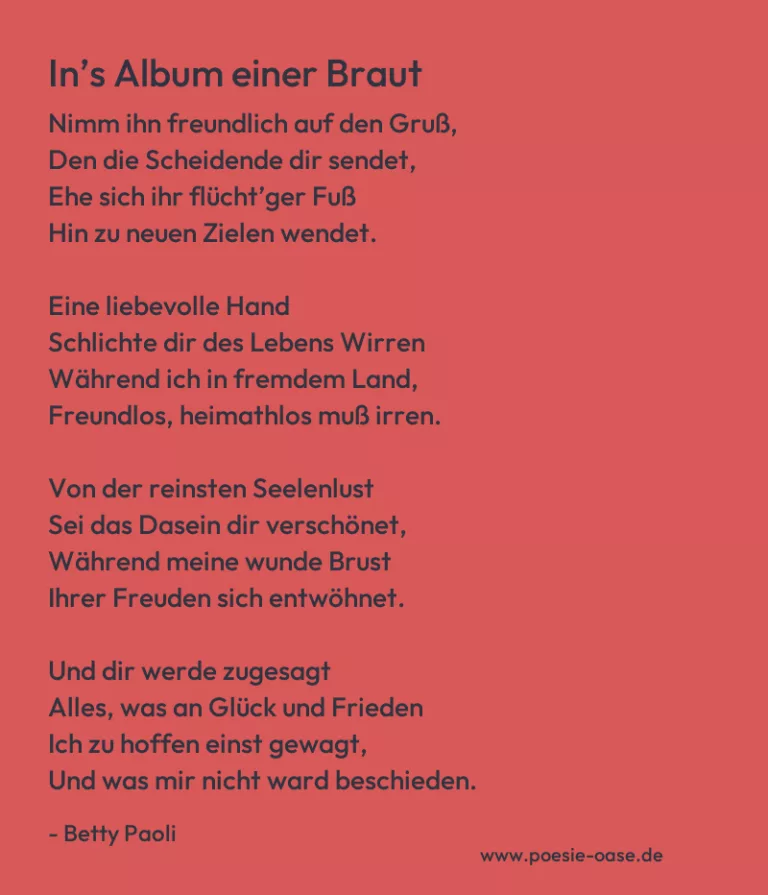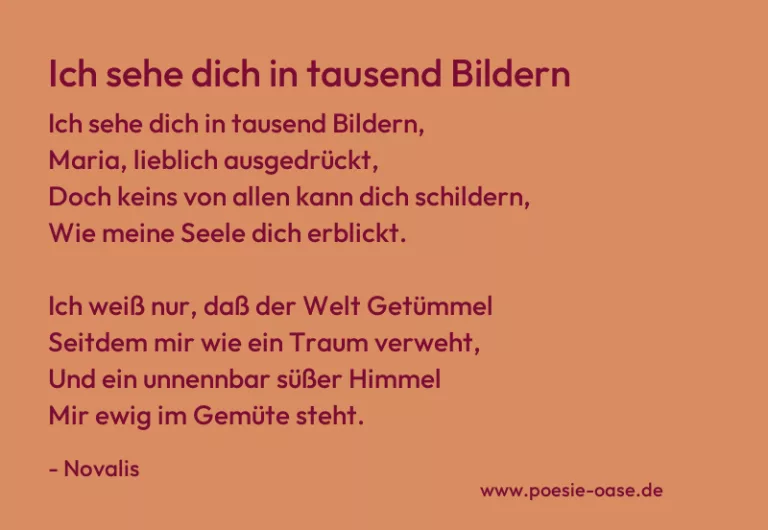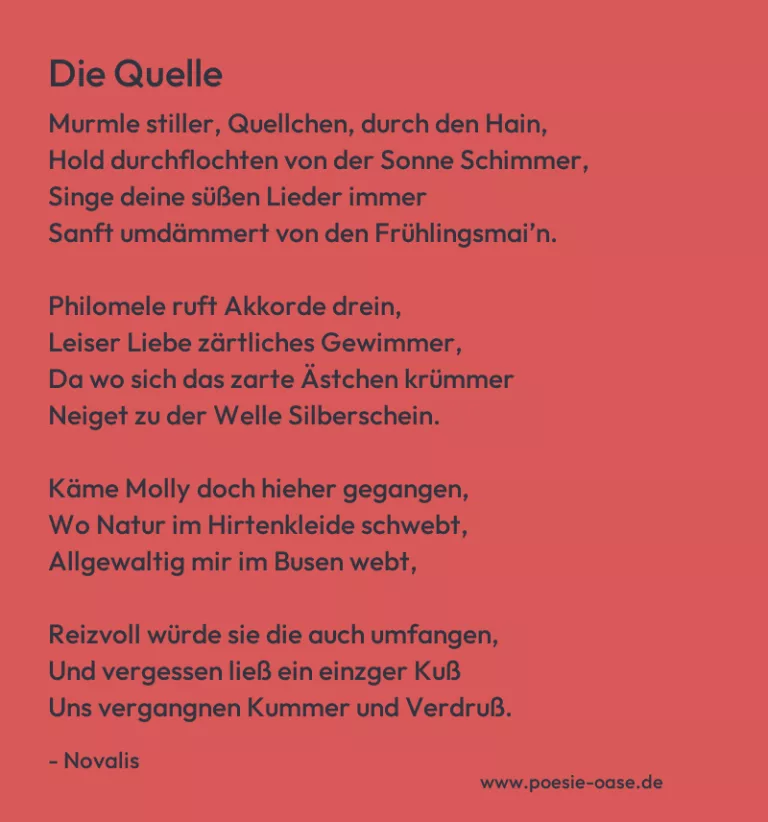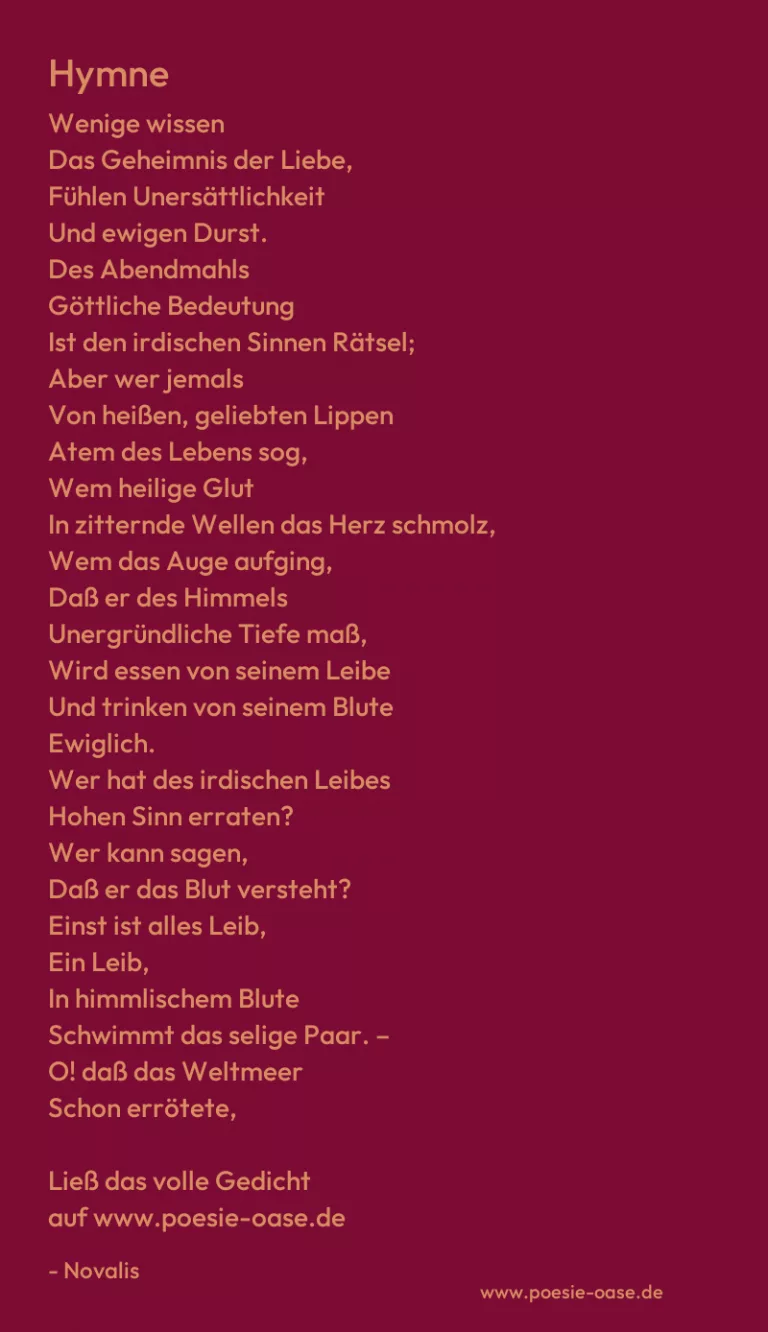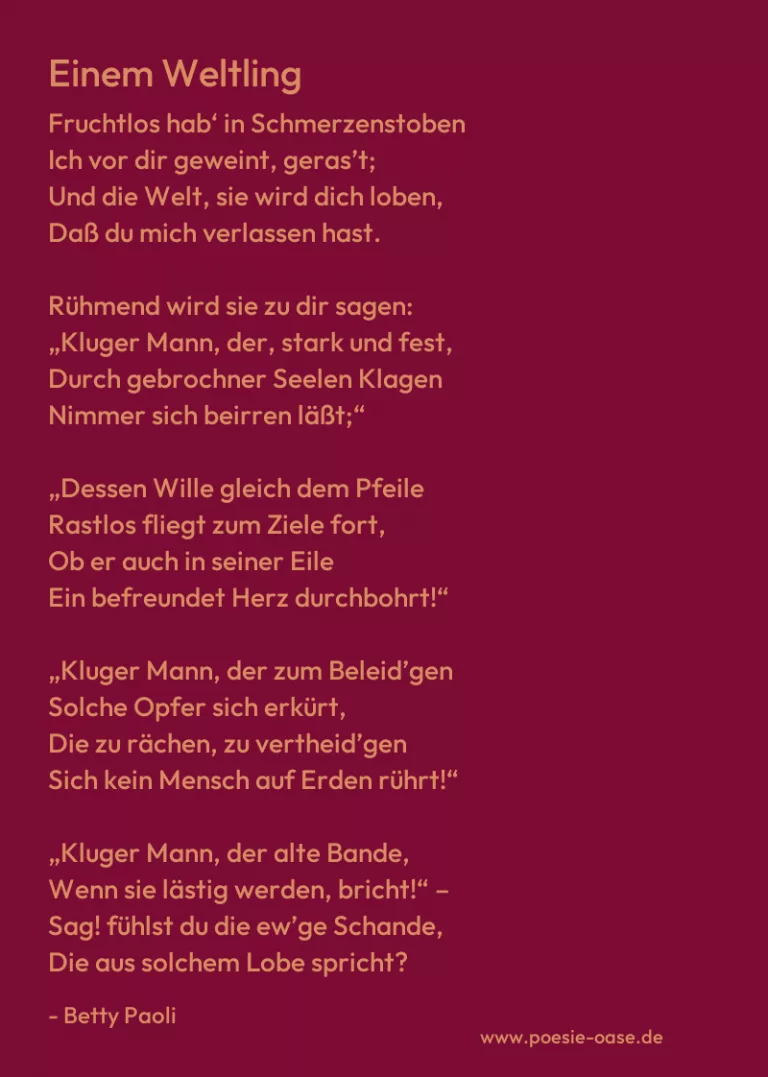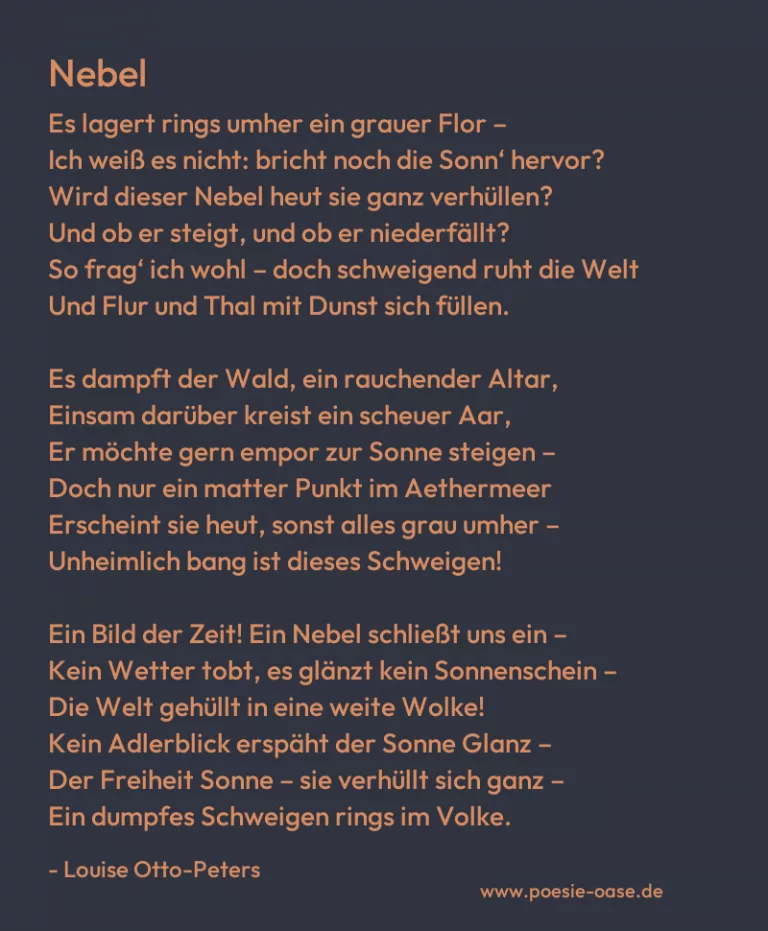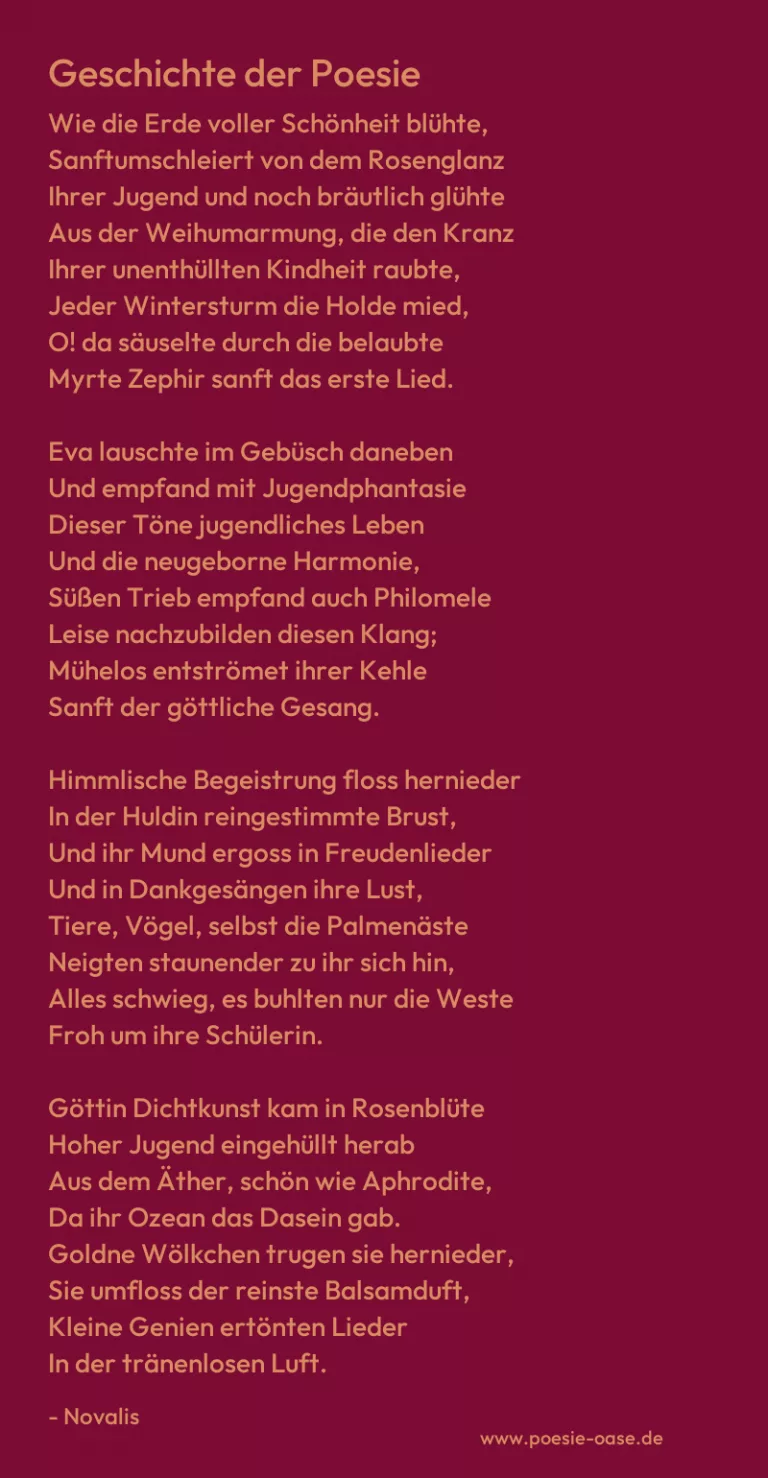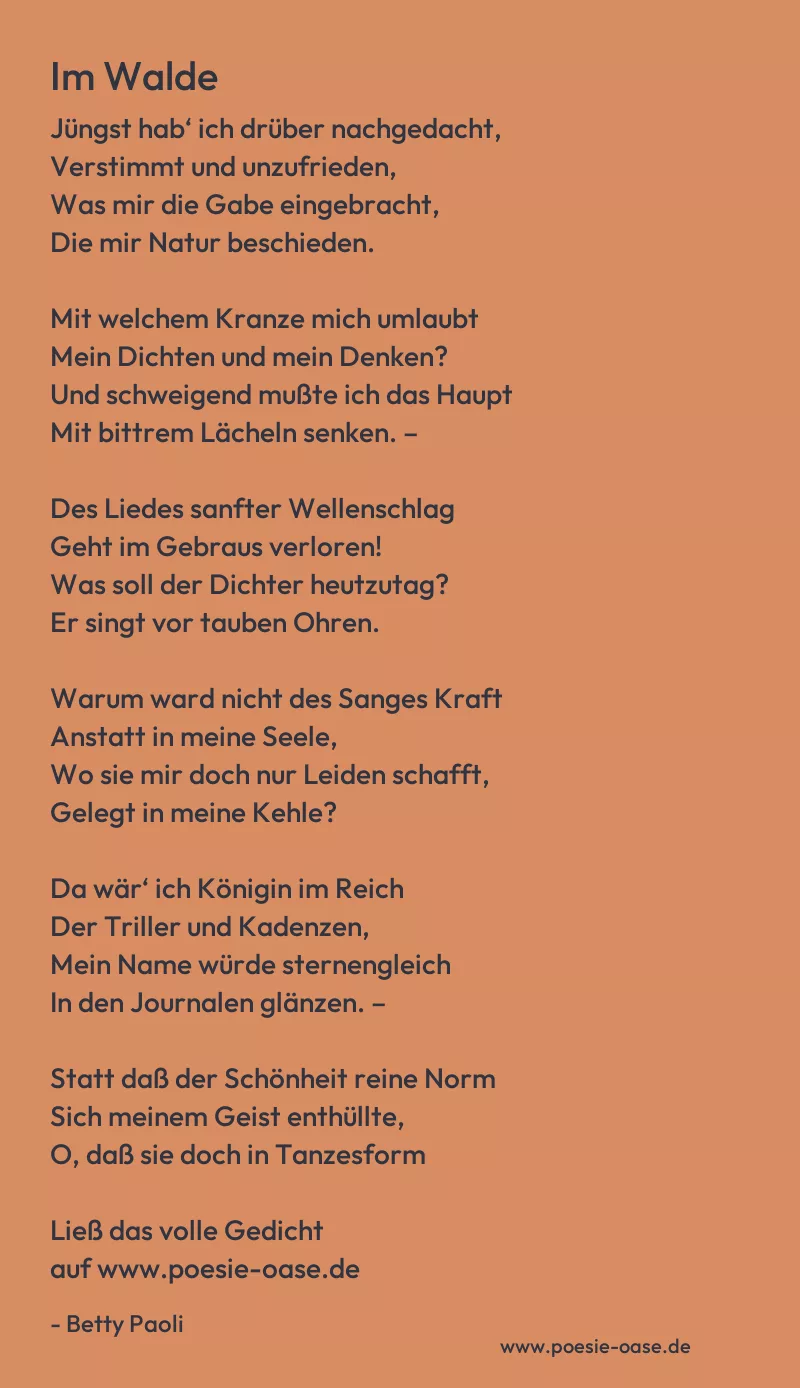Jüngst hab‘ ich drüber nachgedacht,
Verstimmt und unzufrieden,
Was mir die Gabe eingebracht,
Die mir Natur beschieden.
Mit welchem Kranze mich umlaubt
Mein Dichten und mein Denken?
Und schweigend mußte ich das Haupt
Mit bittrem Lächeln senken. –
Des Liedes sanfter Wellenschlag
Geht im Gebraus verloren!
Was soll der Dichter heutzutag?
Er singt vor tauben Ohren.
Warum ward nicht des Sanges Kraft
Anstatt in meine Seele,
Wo sie mir doch nur Leiden schafft,
Gelegt in meine Kehle?
Da wär‘ ich Königin im Reich
Der Triller und Kadenzen,
Mein Name würde sternengleich
In den Journalen glänzen. –
Statt daß der Schönheit reine Norm
Sich meinem Geist enthüllte,
O, daß sie doch in Tanzesform
Mein Gliederspiel erfüllte!
Da würden sie mit Mund und Hand
Mich als „Ereignis“ grüßen!
Zwei Welten lägen, froh entbrannt,
Anbetend mir zu Füßen.
Das wäre mir ein Glückeszug!
Das wären mir Talente,
Die man mit gutem Recht und Fug
Mit diesem Namen nennte! –
So dachte ich, mein Unmut schwoll,
Und ganz von ihm befangen
Bin ich, im Herzen finstern Groll,
Hinaus zum Wald gegangen.
Ein schöner, milder Herbsttag war’s,
Vielleicht die letzte Spende,
Der letzte Sonnenblick des Jahrs,
Das nah schon seinem Ende.
Wohl sprach der Blätter Gelb und Rot
Von Scheiden und Verzichten,
Doch um so treuern Gruß entbot
Das Immergrün der Fichten.
Ein sanfter Geist des Friedens hieß
Mich hier willkommen wieder;
Auf einem moos’gen Steine ließ
Ich mich zur Ruhe nieder.
Hoch über mir das reine Blau,
Um euch ein Meer von Strahlen,
Zu Füßen mir der Morgentau,
Bunt schillernd gleich Opalen!
Es schienen Erd‘ und Himmel traut
In Eines zu verschwimmen!
Da wurd‘ es plötzlich in mir laut
Von wundersamen Stimmen.
In meiner Seele ward es Tag,
Ich jauchzte auf und fühlte,
Wie unsichtbarer Flügelschlag
Die heiße Stirn mir kühlte.
Mein Geist, von frischem Mut geschwellt,
Trieb neue Blütenranken
Und es umwob mich eine Welt
Von tönenden Gedanken. –
Des Leid’s hab‘ ich nicht mehr gedacht,
Davon ich erst beklommen;
Dank einer rätselhaften Macht
War es von mir genommen.
Lebendig ward mir im Gemüt
Der eig’nen Kraft Erinnern,
Und tief beseligt, dankerglüht
Rief es in meinem Innern:
Trinkt immerhin vom gold’nen Wein
Des Ruhms in vollen Zügen!
Mir ward die Gabe, die allein
Sich selber kann genügen!
Die Kunst, die himmelangehaucht,
In stillen Waldeslauben,
Den Beifall nicht der Menge braucht
Um an sich selbst zu glauben.
Ihr müßt nach einem Publikum
Mit Sehnsuchtblicken spähen,
Und bleibt dies ferne oder stumm,
So ist’s um euch geschehen!
Doch
meine
Herrin, Poesie,
Tritt allwärts mir entgegen,
Am öd’sten Strand entböte sie
Mir ihren Gruß und Segen.
Sie hebt mich über all den Wust
Mit ihren starken Schwingen
Und heißet frisch in meiner Brust
Des Liedes Quellen springen.
Und wenn dem Lied voll Lust und Schmerz
Auch keine Seele lauschet,
Genug, daß es mein eig’nes Herz
Begeistert und berauschet!
Nehmt Gold und Ruhm als Lohn dahin,
Sirenen und Silphiden!
Mir ward der Dichtkunst Strahl – ich bin
Mit meinem Teil zufrieden!