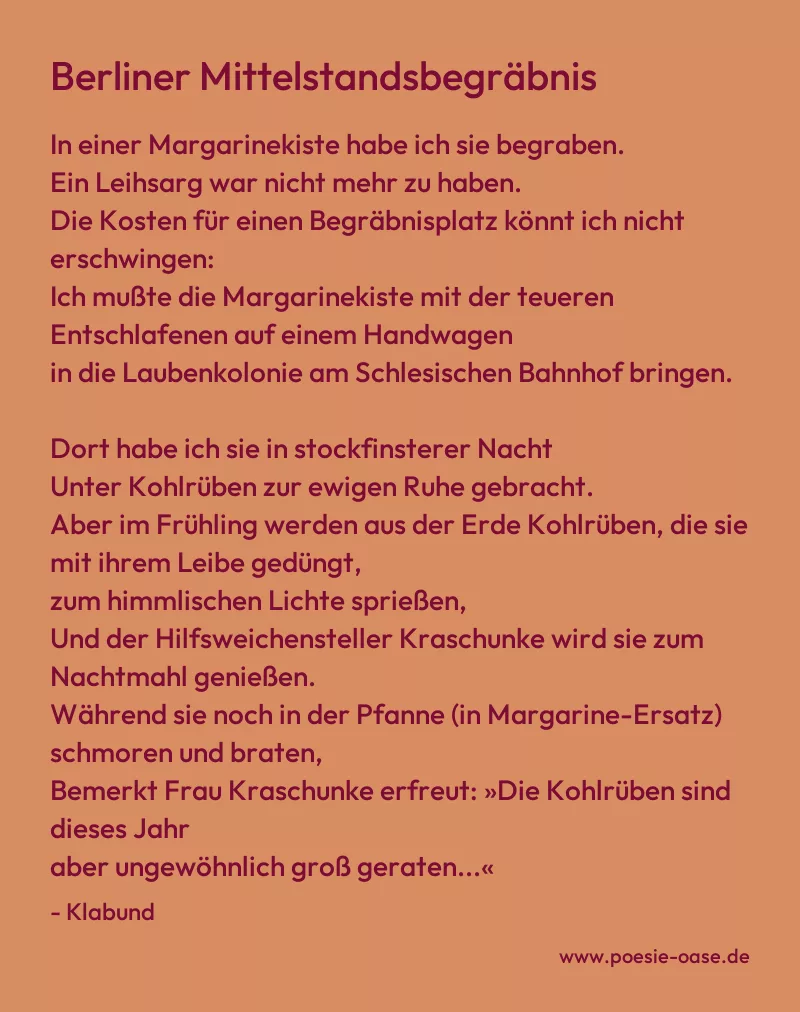Berliner Mittelstandsbegräbnis
In einer Margarinekiste habe ich sie begraben.
Ein Leihsarg war nicht mehr zu haben.
Die Kosten für einen Begräbnisplatz könnt ich nicht erschwingen:
Ich mußte die Margarinekiste mit der teueren Entschlafenen auf einem Handwagen
in die Laubenkolonie am Schlesischen Bahnhof bringen.
Dort habe ich sie in stockfinsterer Nacht
Unter Kohlrüben zur ewigen Ruhe gebracht.
Aber im Frühling werden aus der Erde Kohlrüben, die sie mit ihrem Leibe gedüngt,
zum himmlischen Lichte sprießen,
Und der Hilfsweichensteller Kraschunke wird sie zum Nachtmahl genießen.
Während sie noch in der Pfanne (in Margarine-Ersatz) schmoren und braten,
Bemerkt Frau Kraschunke erfreut: »Die Kohlrüben sind dieses Jahr
aber ungewöhnlich groß geraten…«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
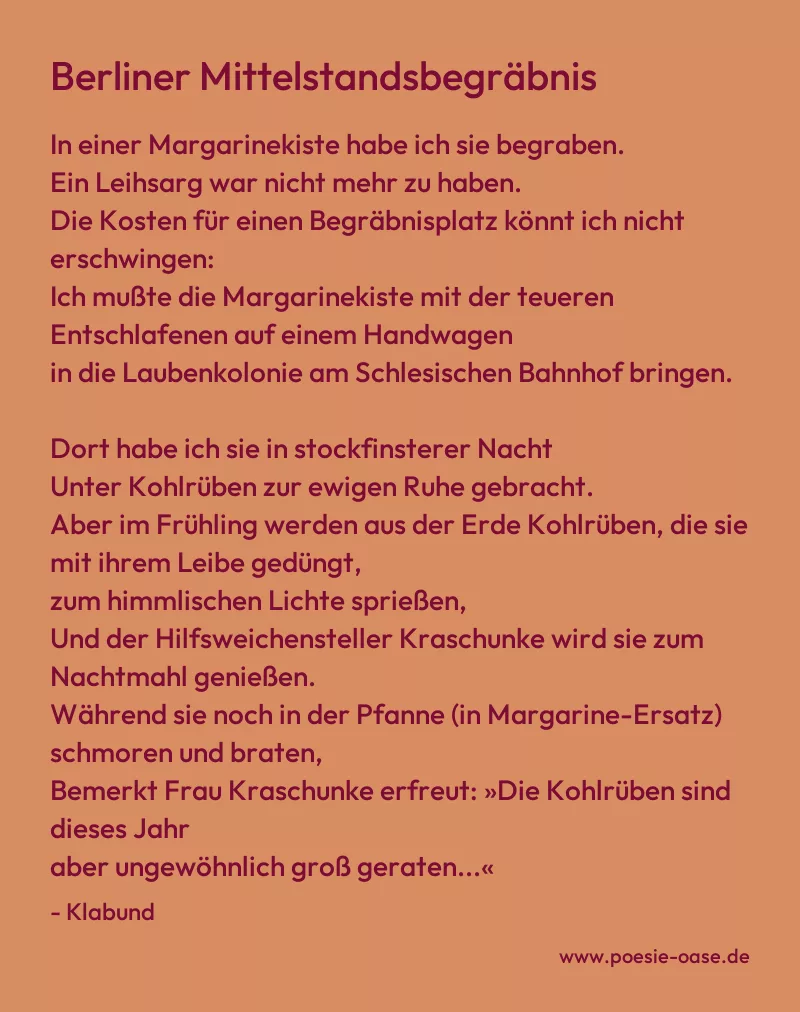
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Berliner Mittelstandsbegräbnis“ von Klabund zeichnet ein erschütterndes Bild der Armut und des sozialen Abstiegs im Berlin der 1920er Jahre. Die drastische Darstellung der Beerdigung einer verstorbenen Person, mutmaßlich eine Frau, in einer Margarinekiste und ohne Grab auf einem Friedhof, offenbart die Verzweiflung und die materiellen Nöte des Erzählers. Der Mangel an Ressourcen zwingt ihn zu ungewöhnlichen und entwürdigenden Maßnahmen, die die tiefe Armut und die Unfähigkeit, einen würdigen Abschied zu gewähren, hervorheben.
Die Wahl der Requisiten, insbesondere der Margarinekiste und der Kohlrüben, verstärkt die soziale Kritik. Die Margarinekiste, ein Zeichen für mangelnde finanzielle Möglichkeiten, steht im krassen Gegensatz zu der vermeintlichen Würde eines Begräbnisses. Die endgültige Ruhestätte unter Kohlrüben in einer Laubenkolonie, wo die Verstorbene auf tragische Weise zum Dünger für diese Pflanzen wird, unterstreicht die Absurdität und Hoffnungslosigkeit der Situation. Das Gedicht zeigt auf schmerzliche Weise, wie das Leben und der Tod im Kontext extremer Armut entwertet werden.
Die Pointe des Gedichts, die darin besteht, dass Frau Kraschunke, die Helferin des Hilfsweichenstellers, die Kohlrüben, die von der Verstorbenen gedüngt wurden, für das Abendessen zubereitet, ist zynisch und makaber. Diese Wendung verdeutlicht die Zirkularität des Lebens und des Todes und die erbärmliche Situation des Erzählers, der unfähig ist, der Verstorbenen die angemessene Ruhe zu verschaffen. Die Erwähnung der Margarine-Ersatz, in dem die Kohlrüben gebraten werden, rundet das Bild der Armut und des Mangels ab.
Klabunds Gedicht ist eine scharfe Gesellschaftskritik, die die sozialen Ungleichheiten und die Härten des Lebens im Berlin der Weimarer Republik aufdeckt. Durch die Kombination von drastischen Bildern, makabrem Humor und einer einfachen, aber wirkungsvollen Sprache erzeugt der Autor eine eindringliche Darstellung des sozialen Abstiegs und der Würdelosigkeit, die mit Armut einhergehen kann. Das Gedicht ist eine Mahnung an die menschliche Würde und die Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.