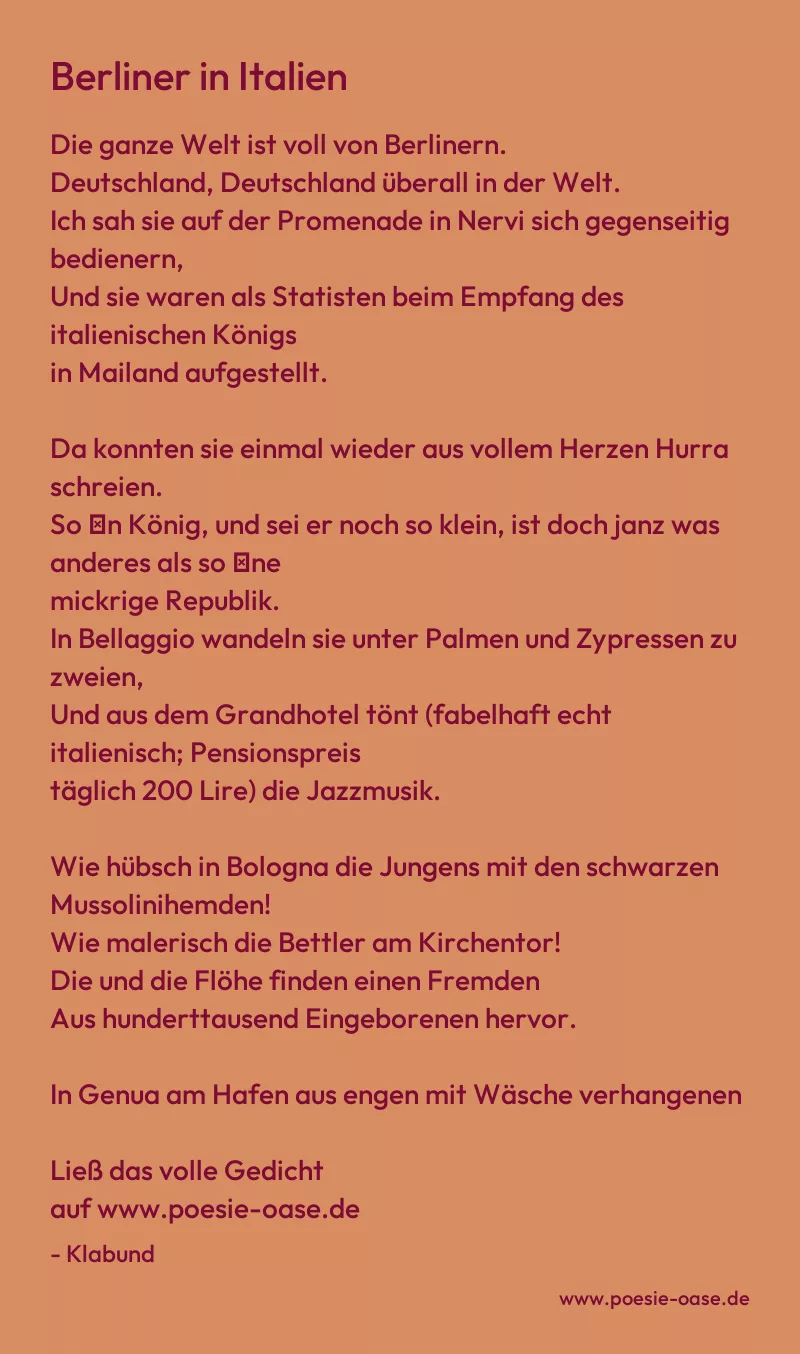Die ganze Welt ist voll von Berlinern.
Deutschland, Deutschland überall in der Welt.
Ich sah sie auf der Promenade in Nervi sich gegenseitig bedienern,
Und sie waren als Statisten beim Empfang des italienischen Königs
in Mailand aufgestellt.
Da konnten sie einmal wieder aus vollem Herzen Hurra schreien.
So ′n König, und sei er noch so klein, ist doch janz was anderes als so ′ne
mickrige Republik.
In Bellaggio wandeln sie unter Palmen und Zypressen zu zweien,
Und aus dem Grandhotel tönt (fabelhaft echt italienisch; Pensionspreis
täglich 200 Lire) die Jazzmusik.
Wie hübsch in Bologna die Jungens mit den schwarzen Mussolinihemden!
Wie malerisch die Bettler am Kirchentor!
Die und die Flöhe finden einen Fremden
Aus hunderttausend Eingeborenen hervor.
In Genua am Hafen aus engen mit Wäsche verhangenen Gassen winken
Schwarzäugige Mädchen und sind bereit,
Gegen entsprechendes Honorar sich abzuschminken.
O du fröhliche, o du selige Frühlingszeit.
Dagegen das Kolosseum, die ollen Klamotten, die verstaubten Geschichten,
Das haben wir zu Hause auf halb bebautem Gelände auch, nu jewiß.
Den schiefen Turm von Pisa sollten sie mal jrade richten.
Mussolini hat dazu den nötigen Schmiß.
Über diesem Lande schweben egal weg die Musen,
Man sehe sich die Brera und die Uffizien an.
Die mageren Weiber von Botticelli kann ich nich verknusen,
Aber Rubens, det is mein Mann.
Wohin man sieht, spuckt einer oder verrichtet sonst eine Notdurft:
es ist ein echt volkstümliches Treiben.
Prächtig dies Monomuent Vittorio Emmanueles in Rom: goldbronziert
und die Säulenhalle aus weißem Gips.
Dafür kann mir das ganze Forum jestohlen bleiben.
Ich bin modern. A proposito: haben Sie für Karlshorst sichere Tips?