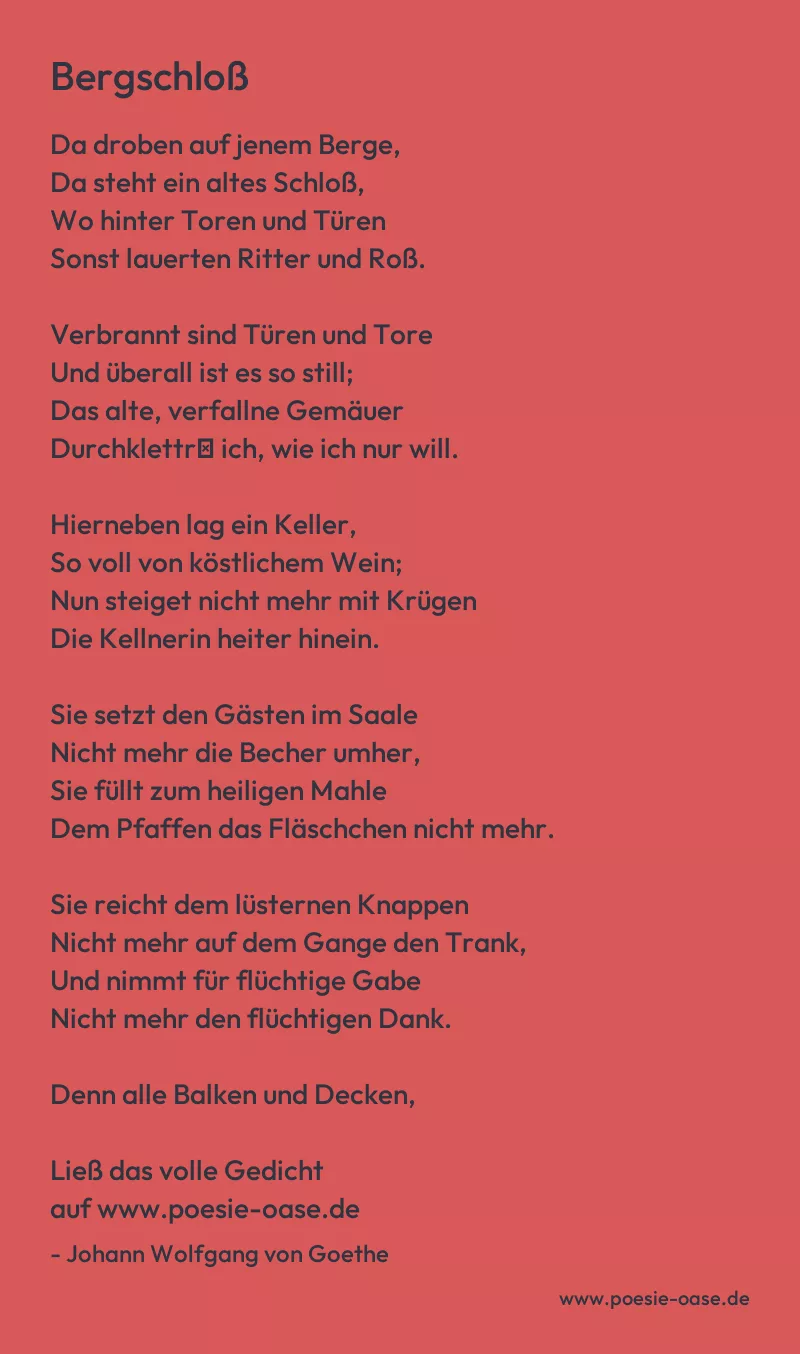Da droben auf jenem Berge,
Da steht ein altes Schloß,
Wo hinter Toren und Türen
Sonst lauerten Ritter und Roß.
Verbrannt sind Türen und Tore
Und überall ist es so still;
Das alte, verfallne Gemäuer
Durchklettr′ ich, wie ich nur will.
Hierneben lag ein Keller,
So voll von köstlichem Wein;
Nun steiget nicht mehr mit Krügen
Die Kellnerin heiter hinein.
Sie setzt den Gästen im Saale
Nicht mehr die Becher umher,
Sie füllt zum heiligen Mahle
Dem Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.
Sie reicht dem lüsternen Knappen
Nicht mehr auf dem Gange den Trank,
Und nimmt für flüchtige Gabe
Nicht mehr den flüchtigen Dank.
Denn alle Balken und Decken,
Sie sind schon lange verbrannt,
Und Trepp′ und Gang und Kapelle
In Schutt und Trümmer verwandt.
Doch als mit Zither und Flasche
Nach diesen felsigen Höh′n
Ich an dem heitersten Tage
Mein Liebchen steigen geseh′n,
Da drängte sich frohes Behagen
Hervor aus verödeter Ruh′,
Da ging′s wie in alten Tagen
Recht feierlich wieder zu;
Als wären für stattliche Gäste
Die weitesten Räume bereit,
Als käm′ ein Pärchen gegangen
Aus jener tüchtigen Zeit;
Als stünd′ in seiner Kapelle
Der würdige Pfaffe schon da,
Und fragte: „Wollt ihr einander?“
Wir aber lächelten: „Ja!“
Und tief bewegten Gesänge
Des Herzens innigsten Grund;
Es zeugte statt der Menge
Der Echo schallender Mund.
Und als sich gegen den Abend
Im stillen alles verlor,
Da blickte die glühende Sonne
Zum schroffen Gipfel empor.
Und Knapp′ und Kellnerin glänzen
Als Herren weit und breit;
Sie nimmt sich zum Kredenzen
Und er zum Danke sich Zeit.