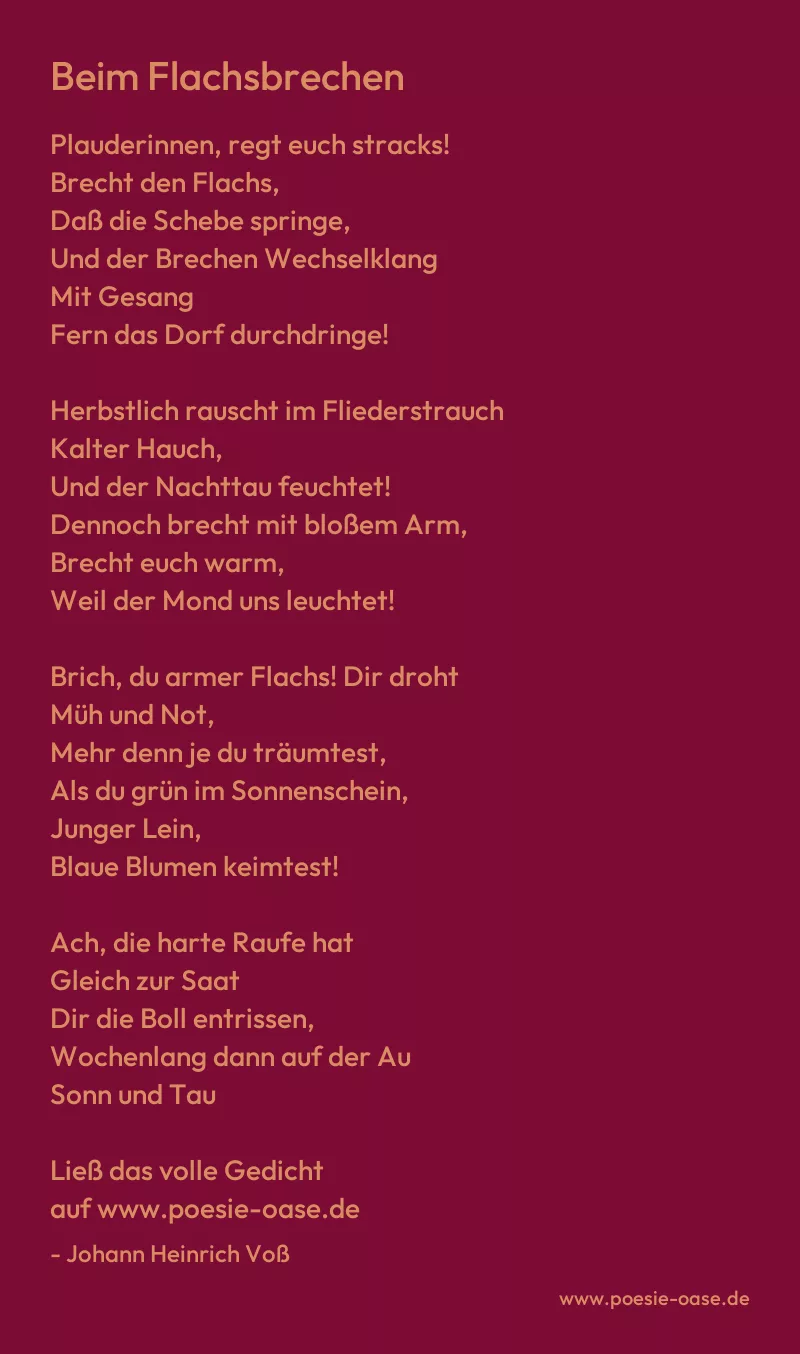Plauderinnen, regt euch stracks!
Brecht den Flachs,
Daß die Schebe springe,
Und der Brechen Wechselklang
Mit Gesang
Fern das Dorf durchdringe!
Herbstlich rauscht im Fliederstrauch
Kalter Hauch,
Und der Nachttau feuchtet!
Dennoch brecht mit bloßem Arm,
Brecht euch warm,
Weil der Mond uns leuchtet!
Brich, du armer Flachs! Dir droht
Müh und Not,
Mehr denn je du träumtest,
Als du grün im Sonnenschein,
Junger Lein,
Blaue Blumen keimtest!
Ach, die harte Raufe hat
Gleich zur Saat
Dir die Boll entrissen,
Wochenlang dann auf der Au
Sonn und Tau
Röstend dich zerrissen!
Nun zerquetschen wir in Hast
Dir den Bast,
Den die Schwinge reinigt;
Von der bösen Hechel itzt,
Scharfgespitzt,
Wirst du durchgepeinigt!
Doch dann prangst du glatt und schön;
Und wir drehn
Dich in saubre Knocken:
Und getrillt mit flinkem Fuß,
Feucht vom Kuß,
Läufst du uns vom Rocken!
Schnell durch Spul und Haspel eilt,
Schön geknäult,
Drauf dein Garn zur Webe:
Daß die Leinwand, scharf gebeucht,
Und gebleicht,
Hemd und Laken gebe!
Brich, o brich, du armer Flachs!
Weiß wie Wachs,
Prangst du angeschmieget,
Wann beim Bräutigam die Braut,
Warm und traut,
Einst im Bette lieget!