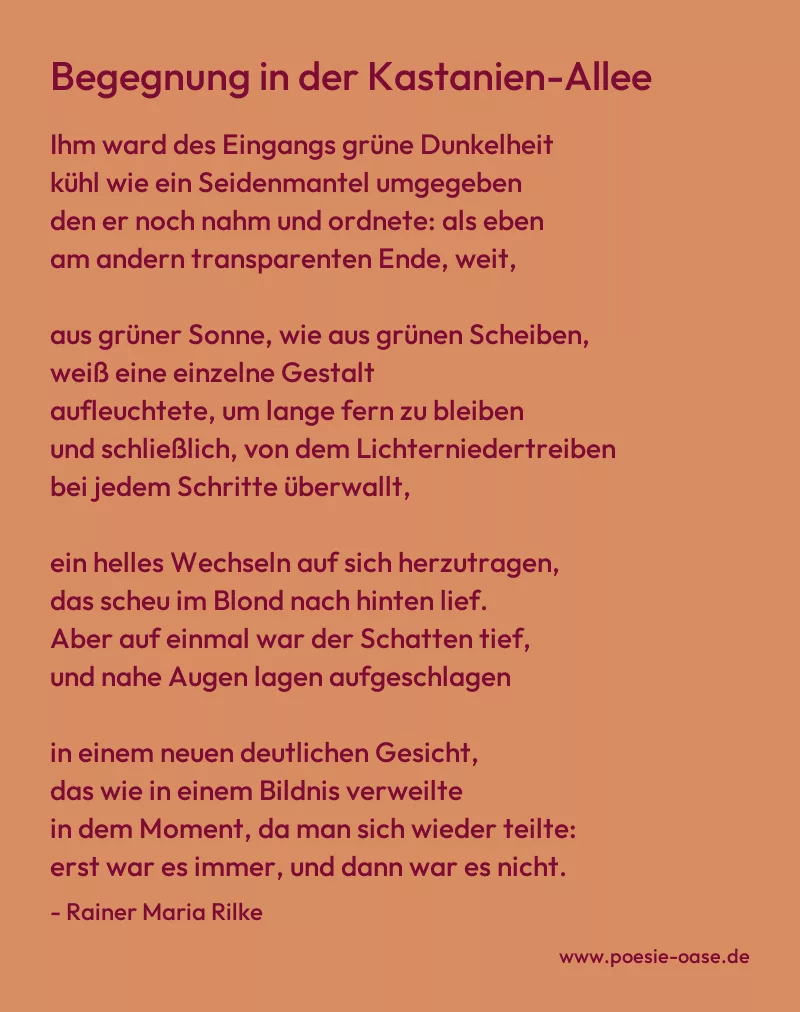Begegnung in der Kastanien-Allee
Ihm ward des Eingangs grüne Dunkelheit
kühl wie ein Seidenmantel umgegeben
den er noch nahm und ordnete: als eben
am andern transparenten Ende, weit,
aus grüner Sonne, wie aus grünen Scheiben,
weiß eine einzelne Gestalt
aufleuchtete, um lange fern zu bleiben
und schließlich, von dem Lichterniedertreiben
bei jedem Schritte überwallt,
ein helles Wechseln auf sich herzutragen,
das scheu im Blond nach hinten lief.
Aber auf einmal war der Schatten tief,
und nahe Augen lagen aufgeschlagen
in einem neuen deutlichen Gesicht,
das wie in einem Bildnis verweilte
in dem Moment, da man sich wieder teilte:
erst war es immer, und dann war es nicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
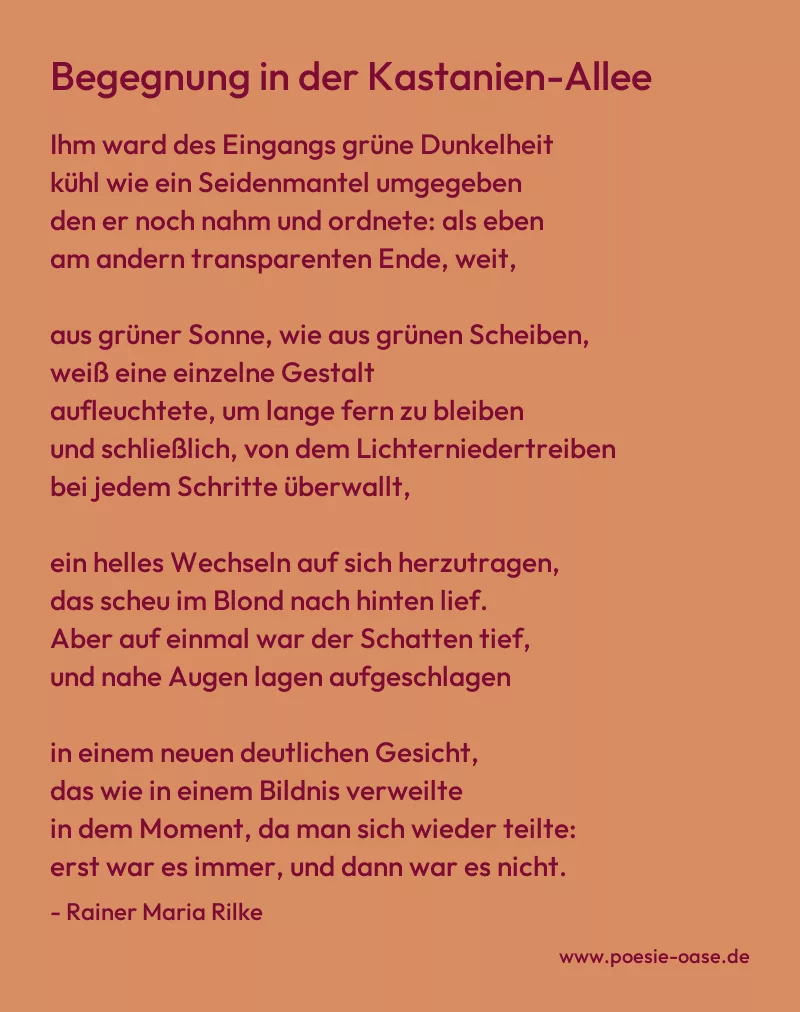
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Begegnung in der Kastanien-Allee“ von Rainer Maria Rilke beschreibt in eindrucksvollen Bildern eine flüchtige Begegnung, die den Leser in eine Welt der flüchtigen Eindrücke und tiefen Emotionen entführt. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung des Eingangs zur Allee, einer „grünen Dunkelheit“, die den Protagonisten wie ein „Seidenmantel“ umgibt. Diese einleitende Szene etabliert eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Übergangs, die durch die metaphorische Verwendung von Licht und Schatten weiter verstärkt wird.
Die eigentliche Begegnung wird durch das Aufleuchten einer „einzelnen Gestalt“ aus dem Licht der grünen Sonne inszeniert. Dieser Moment der Wahrnehmung ist von großer Intensität, da die Gestalt zunächst in weiter Ferne erscheint und dann durch das „Lichterniedertreiben“ der Umgebung bei jedem Schritt näherkommt. Rilke erzeugt hier eine Spannung durch die Distanz und die sich langsam nähernde Präsenz, die das Gefühl des Ungreifbaren und Flüchtigen der Begegnung unterstreicht. Die Beschreibung des „hellen Wechseln“ auf der Gestalt, die „scheu im Blond nach hinten lief“, deutet auf eine gewisse Zurückhaltung und das gleichzeitige Erscheinen von Schönheit hin.
Die Intensität des Moments erreicht ihren Höhepunkt, als die „nahen Augen“ in einem „deutlichen Gesicht“ auftauchen. Dieser Moment ist von größter Bedeutung, da er die unmittelbare Nähe und den direkten Blickkontakt suggeriert, die für eine tiefe emotionale Verbindung stehen. Das „Bildnis“ verweilt in dem Moment, bevor die Figuren sich wieder trennen – ein Hinweis auf die Kürze und Flüchtigkeit der Begegnung. Der letzte Vers „erst war es immer, und dann war es nicht“ fasst die zentrale Thematik des Gedichts zusammen: die Vergänglichkeit der Wahrnehmung und die flüchtige Natur menschlicher Beziehungen.
Rilke verwendet in diesem Gedicht eine bildreiche und metaphorische Sprache, um die flüchtigen Momente der menschlichen Existenz einzufangen. Die Beschreibung der Farben, des Lichts und der Schatten erzeugt eine sinnliche Erfahrung, die über das rein Visuelle hinausgeht. Die subtile Verwendung von Adjektiven wie „grün“, „weiß“ und „hell“ verstärkt die Atmosphäre und unterstreicht die Flüchtigkeit der Begegnung. Das Gedicht vermittelt die Idee, dass bedeutsame Momente oft flüchtig sind und im Gedächtnis als lebendige Bilder fortbestehen, die sich der rationalen Erfassung entziehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.