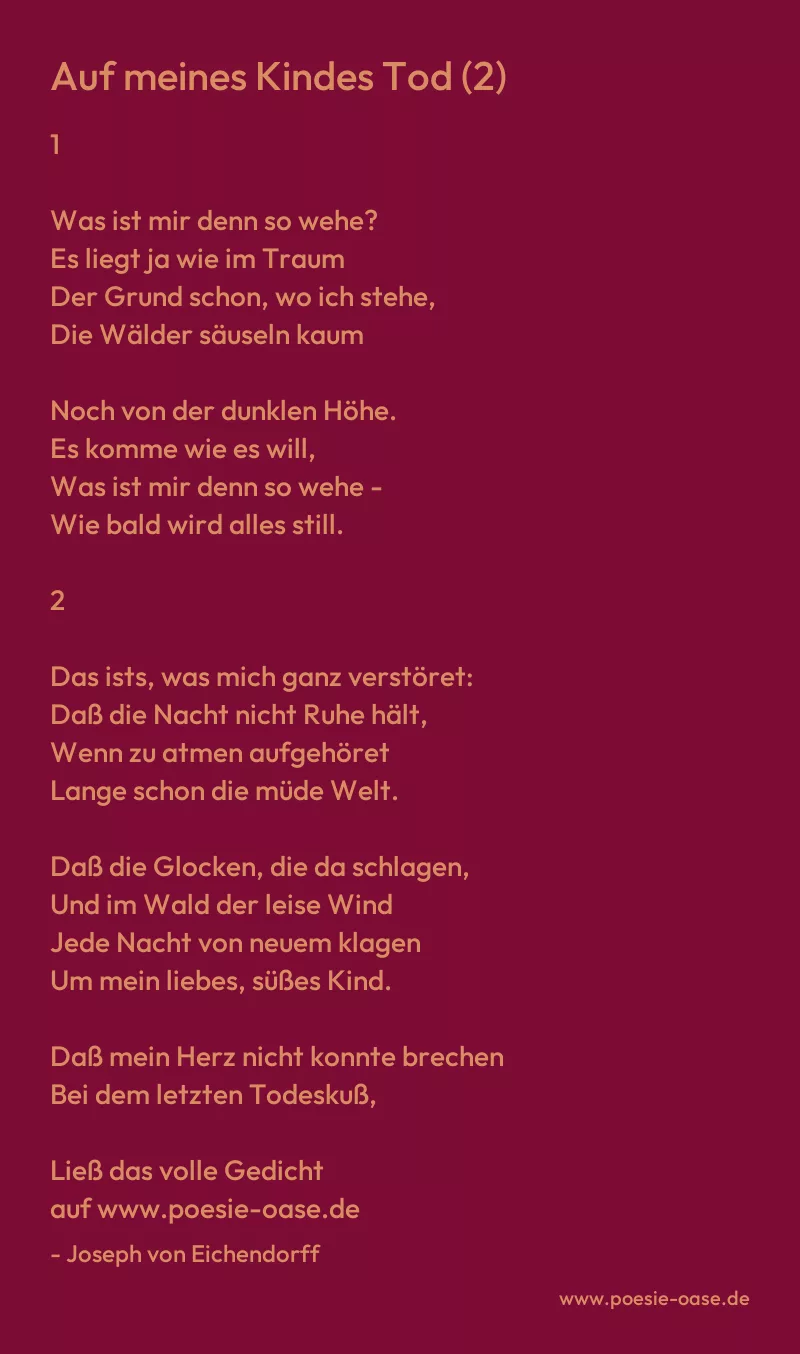Auf meines Kindes Tod (2)
1
Was ist mir denn so wehe?
Es liegt ja wie im Traum
Der Grund schon, wo ich stehe,
Die Wälder säuseln kaum
Noch von der dunklen Höhe.
Es komme wie es will,
Was ist mir denn so wehe –
Wie bald wird alles still.
2
Das ists, was mich ganz verstöret:
Daß die Nacht nicht Ruhe hält,
Wenn zu atmen aufgehöret
Lange schon die müde Welt.
Daß die Glocken, die da schlagen,
Und im Wald der leise Wind
Jede Nacht von neuem klagen
Um mein liebes, süßes Kind.
Daß mein Herz nicht konnte brechen
Bei dem letzten Todeskuß,
Daß ich wie im Wahnsinn sprechen
Nun in irren Liedern muß.
3
Von fern die Uhren schlagen,
Es ist schon tiefe Nacht,
Die Lampe brennt so düster,
Dein Bettlein ist gemacht.
Die Winde nur noch gehen
Wehklagend um das Haus,
Wir sitzen einsam drinnen
Und lauschen oft hinaus.
Es ist, als müßtest leise
Du klopfen an die Tür,
Du hättst dich nur verirret,
Und kämst nun müd zurück.
Wir armen, armen Toren!
Wir irren ja im Graus
Des Dunkels noch verloren –
Du fandst dich längst nach Haus.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
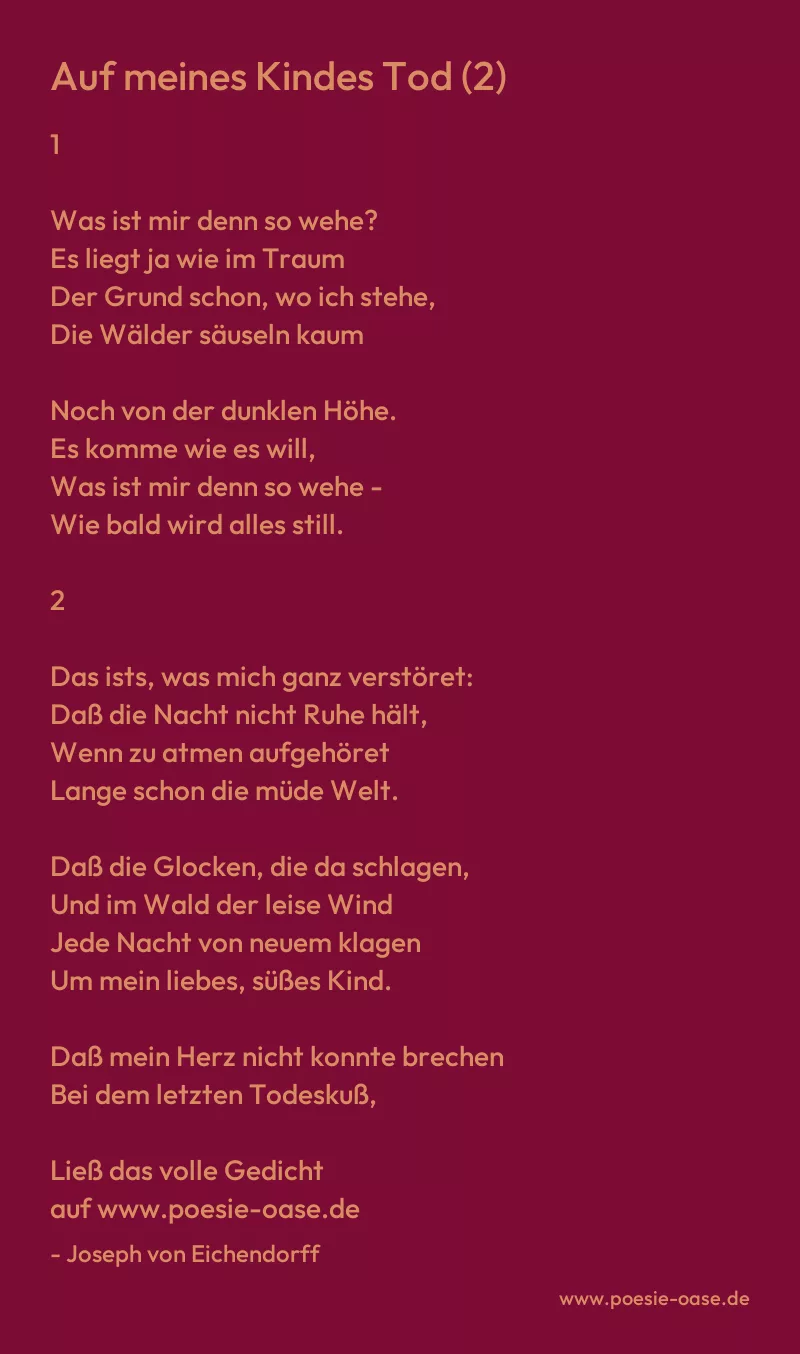
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf meines Kindes Tod (2)“ von Joseph von Eichendorff drückt die tiefe Trauer und den Schmerz eines Elternteils über den Verlust seines Kindes aus. Der erste Vers, „Was ist mir denn so wehe?“, gibt den Ton an und verdeutlicht die Leere und den unerträglichen Schmerz, der den Sprecher befallen hat. Die Beschreibung der Umgebung, wie die kaum säuselnden Wälder, dient dazu, die innere Zerrissenheit und das Gefühl der Entfremdung von der Welt zu verstärken. Die Frage nach der Ursache des Schmerzes, die durch das Gedicht zieht, zeigt die Unfähigkeit, den Verlust zu begreifen und zu akzeptieren.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft die Thematik des Schmerzes und der Unruhe. Die Zeilen „Daß die Nacht nicht Ruhe hält“ drücken die Unfähigkeit des Sprechers aus, im Tod des Kindes Frieden zu finden. Die wiederkehrenden Glockenschläge und der Wind, der klagt, symbolisieren die ständige Erinnerung an den Verlust und die Unaufhörlichkeit des Schmerzes. Die Formulierung „Daß mein Herz nicht konnte brechen“ deutet auf die überwältigende Natur des Schmerzes hin, die den Sprecher zu lähmen scheint. Die Unfähigkeit, mit dem Verlust fertig zu werden, führt dazu, dass der Sprecher in „irren Liedern“ gefangen ist, was die Hoffnungslosigkeit und den Wahnsinn des Trauerns unterstreicht.
Der dritte Teil des Gedichts nimmt eine andere Perspektive ein. Die Beschreibung der Nacht, die düstere Lampe und das leere Bett des Kindes erzeugen eine Atmosphäre der Einsamkeit und Trauer. Der Sprecher und möglicherweise ein anderer Elternteil lauschen den Geräuschen der Nacht, in der Hoffnung, das Kind wiederzuentdecken. Die Vorstellung, dass das Kind sich nur verirrt hat und nun müde nach Hause zurückkehrt, zeugt von der Sehnsucht nach dem Kind und der Weigerung, den Verlust zu akzeptieren. Der abschließende Vers, „Du fandst dich längst nach Haus,“ bietet eine bittersüße Erkenntnis. Während die Eltern noch im „Graus des Dunkels“ irren, hat das Kind seinen Frieden gefunden, was eine resignierte Akzeptanz des Todes und die Hoffnung auf ein Wiedersehen andeutet.
Insgesamt ist das Gedicht eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Schmerz des Verlustes eines Kindes. Eichendorff nutzt bildhafte Sprache und Metaphern, um die innere Zerrissenheit, die Sehnsucht und die Hoffnungslosigkeit des Sprechers zu vermitteln. Das Gedicht bewegt sich zwischen Verzweiflung und einem Hauch von Trost, wodurch die universelle Erfahrung der Trauer und der Suche nach Sinn inmitten des Leids erlebbar wird. Der Kontrast zwischen der irdischen Welt der Eltern und der himmlischen Heimat des Kindes verstärkt die Tragik des Verlustes und die tiefe Liebe, die das Kind hinterlässt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.