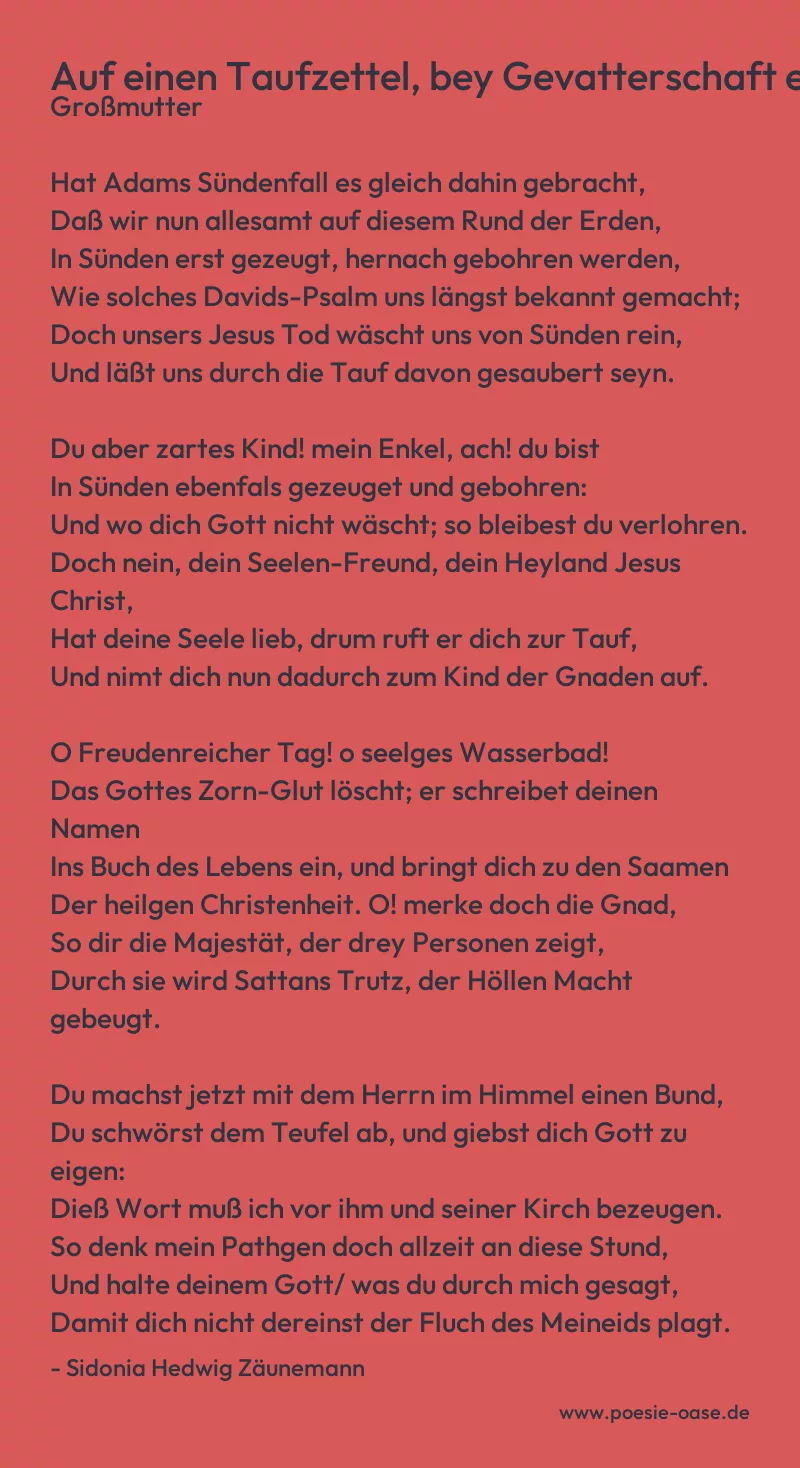Hat Adams Sündenfall es gleich dahin gebracht,
Daß wir nun allesamt auf diesem Rund der Erden,
In Sünden erst gezeugt, hernach gebohren werden,
Wie solches Davids-Psalm uns längst bekannt gemacht;
Doch unsers Jesus Tod wäscht uns von Sünden rein,
Und läßt uns durch die Tauf davon gesaubert seyn.
Du aber zartes Kind! mein Enkel, ach! du bist
In Sünden ebenfals gezeuget und gebohren:
Und wo dich Gott nicht wäscht; so bleibest du verlohren.
Doch nein, dein Seelen-Freund, dein Heyland Jesus Christ,
Hat deine Seele lieb, drum ruft er dich zur Tauf,
Und nimt dich nun dadurch zum Kind der Gnaden auf.
O Freudenreicher Tag! o seelges Wasserbad!
Das Gottes Zorn-Glut löscht; er schreibet deinen Namen
Ins Buch des Lebens ein, und bringt dich zu den Saamen
Der heilgen Christenheit. O! merke doch die Gnad,
So dir die Majestät, der drey Personen zeigt,
Durch sie wird Sattans Trutz, der Höllen Macht gebeugt.
Du machst jetzt mit dem Herrn im Himmel einen Bund,
Du schwörst dem Teufel ab, und giebst dich Gott zu eigen:
Dieß Wort muß ich vor ihm und seiner Kirch bezeugen.
So denk mein Pathgen doch allzeit an diese Stund,
Und halte deinem Gott/ was du durch mich gesagt,
Damit dich nicht dereinst der Fluch des Meineids plagt.