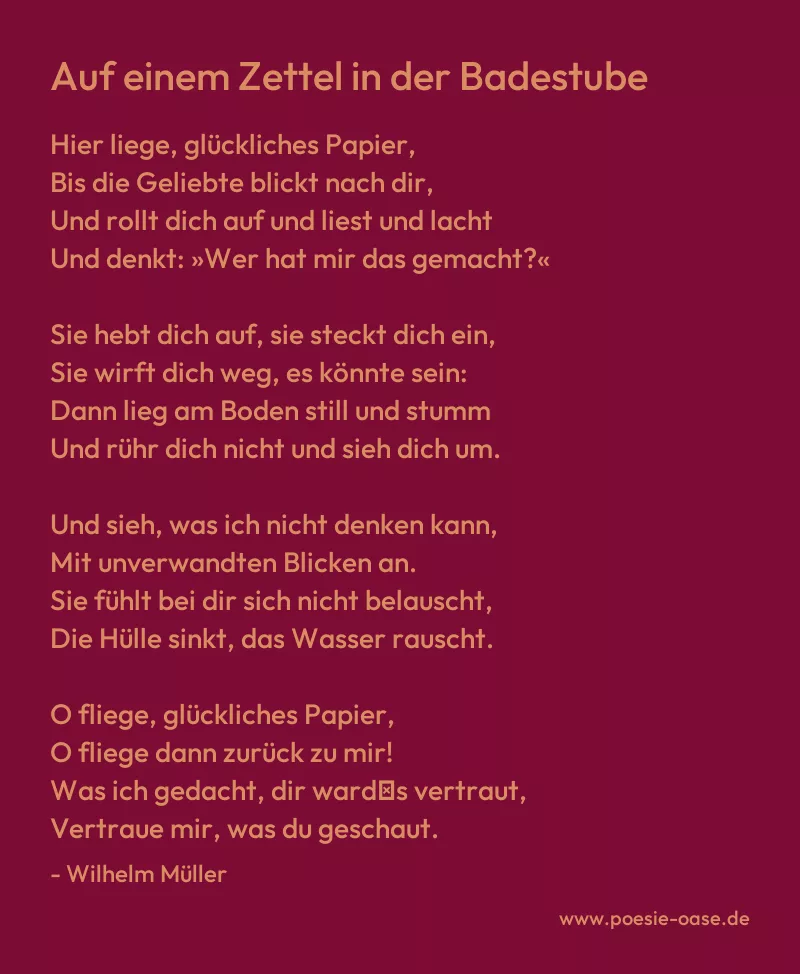Auf einem Zettel in der Badestube
Hier liege, glückliches Papier,
Bis die Geliebte blickt nach dir,
Und rollt dich auf und liest und lacht
Und denkt: »Wer hat mir das gemacht?«
Sie hebt dich auf, sie steckt dich ein,
Sie wirft dich weg, es könnte sein:
Dann lieg am Boden still und stumm
Und rühr dich nicht und sieh dich um.
Und sieh, was ich nicht denken kann,
Mit unverwandten Blicken an.
Sie fühlt bei dir sich nicht belauscht,
Die Hülle sinkt, das Wasser rauscht.
O fliege, glückliches Papier,
O fliege dann zurück zu mir!
Was ich gedacht, dir ward′s vertraut,
Vertraue mir, was du geschaut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
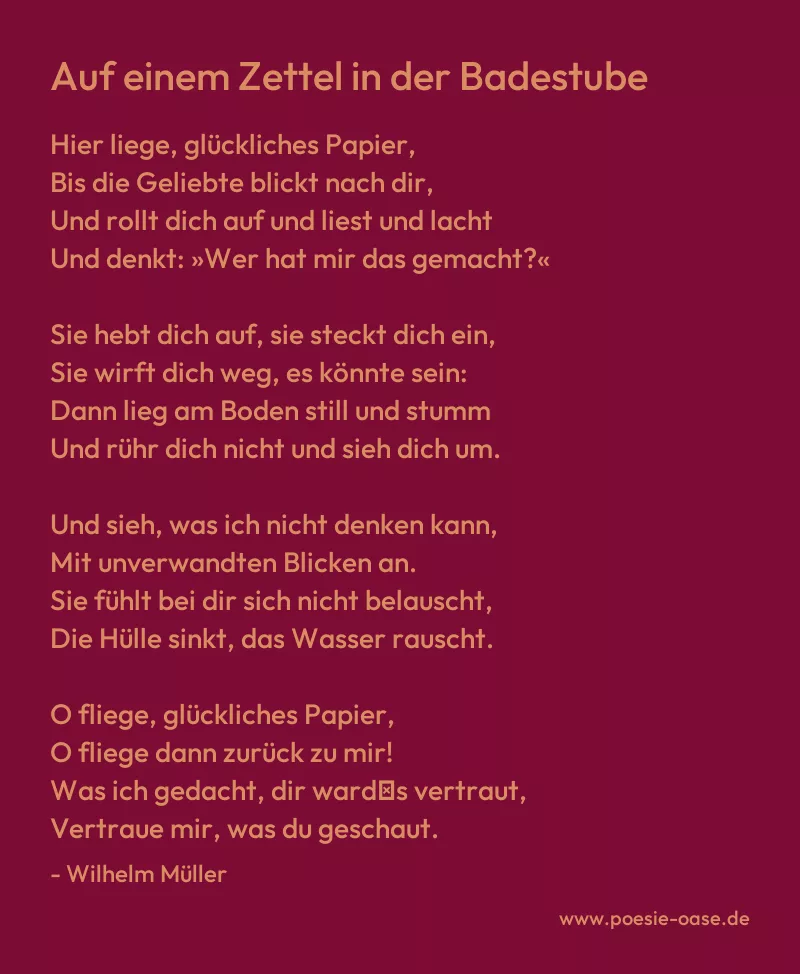
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf einem Zettel in der Badestube“ von Wilhelm Müller entfaltet in einfacher Sprache eine zarte, fast kindliche Sehnsucht nach der Geliebten und der intimen Beziehung, die er zu ihr durch ein kleines Stück Papier aufbaut. Der Text beschreibt eine Art Reise des Zettels, der zum stillen Beobachter und Boten zwischen dem Dichter und der Angebeteten wird. Die Einfachheit des Verses, die Wiederholung bestimmter Worte wie „glückliches“ und die klaren Reime erzeugen einen sanften, fast träumerischen Ton, der die Intimität der beschriebenen Szene unterstreicht.
Das Gedicht lässt sich in mehrere Phasen unterteilen, die die emotionale Entwicklung des Dichters widerspiegeln. Im ersten Abschnitt wird die Hoffnung des Dichters ausgedrückt, dass seine Geliebte den Zettel findet, ihn liest und möglicherweise mit einem Lächeln auf die Botschaft reagiert. Die Vorstellung, dass sie sich wundert, wer den Zettel geschrieben hat, zeugt von einer spielerischen Sehnsucht nach Nähe und einer indirekten Kommunikation. Im zweiten Teil wird die Möglichkeit, dass der Zettel einfach weggelegt oder sogar ignoriert wird, angedeutet. Dieses Szenario impliziert die Angst des Dichters vor Zurückweisung oder der Unbeachtetheit seiner Gefühle.
Der entscheidende Moment des Gedichts liegt in der dritten Strophe. Hier wird der Zettel zum Zeugen einer intimen, fast heiligen Szene, die im Kontext des Badezimmers angesiedelt ist. Während die Geliebte sich der körperlichen Reinigung hingibt, ist der Zettel stiller Beobachter. Die Zeile „Sie fühlt bei dir sich nicht belauscht“ deutet auf eine besondere Vertrautheit und Unbefangenheit hin, die das Papier ermöglicht. Der Dichter wünscht sich, dass der Zettel Zeuge der „Geheimnisse“ wird, die er selbst nicht denken kann, was die Sehnsucht nach dem Wissen über die Geliebte und deren innersten Gedanken unterstreicht.
Die letzte Strophe gipfelt in einem innigen Appell an das Papier. Der Dichter bittet es, zurückzukehren, ihm das zu verraten, was es gesehen hat, und damit die Kluft zwischen den beiden zu überbrücken. Dieser Wunsch nach Austausch und das Vertrauen in das Papier als Bote verdeutlichen das starke Bedürfnis nach einer tiefen, ungeteilten Verbindung. Das Gedicht ist somit eine subtile Liebeserklärung, die durch die Einfachheit des Ausdrucks und die Intimität der gewählten Umgebung eine besondere Poesie entfaltet. Es handelt von der Sehnsucht nach Nähe, dem Wunsch nach gegenseitigem Verständnis und der Schönheit der kleinen, unscheinbaren Gesten in der Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.