Aber der Leib war Erz des Achill! Der Tochter des Ares
Geb ich zum Essen, beim Styx, nichts als die Ferse nur preis.
Archäologischer Einwand
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
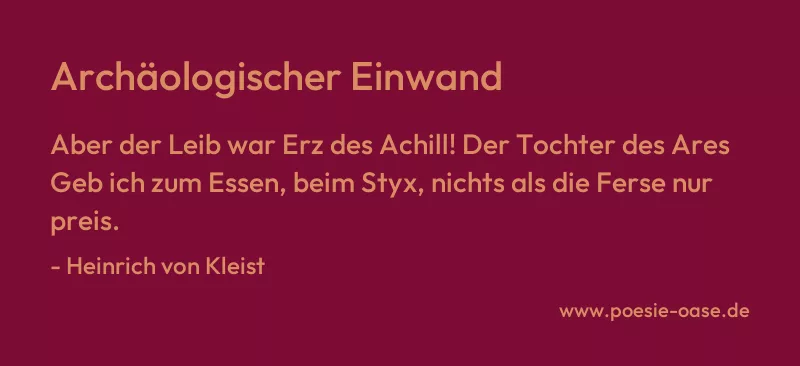
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Archäologischer Einwand“ von Heinrich von Kleist ist eine kurze, prägnante Auseinandersetzung mit der Unsterblichkeit und der menschlichen Schwäche, eingebettet in eine mythologische Szenerie. Es beschreibt einen fiktiven Einwand gegen die Unverwundbarkeit des griechischen Helden Achilles.
Der erste Vers stellt fest, dass Achilles’ Körper aus Erz bestand, was ihn nahezu unverwundbar machte. Kleist nutzt hier die Vorstellung des Erz-Körpers, um die nahezu perfekte Unsterblichkeit des Helden zu unterstreichen. Durch diese Beschreibung etabliert er einen Kontrast zu dem, was im zweiten Vers folgt, und hebt die Ausnahme hervor, die zum Scheitern führen kann.
Der zweite Vers, der den Kern der Aussage darstellt, formuliert einen „archäologischen Einwand“: Der Erz-Körper, der Achilles Unsterblichkeit verleiht, wurde durch seine Ferse unterbrochen, die er dem Schicksal zum Fraß vorwirft. Kleist verdichtet hier die ganze Tragik der Achilles-Sage auf die eine verwundbare Stelle, die durch seine Mutter Thetis, Tochter des Ares, exponiert wurde.
Das Gedicht berührt die Themen Unsterblichkeit, Verletzlichkeit und die letztendliche Macht des Schicksals. Es ist ein Kommentar über die menschliche Unvollkommenheit, die selbst einen Helden wie Achilles dem Tod unterwirft. Durch die Verwendung einer bildreichen Sprache und die Konzentration auf ein detailreiches Detail gelingt es Kleist, eine komplexe philosophische Überlegung auf wenigen Zeilen zu transportieren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
