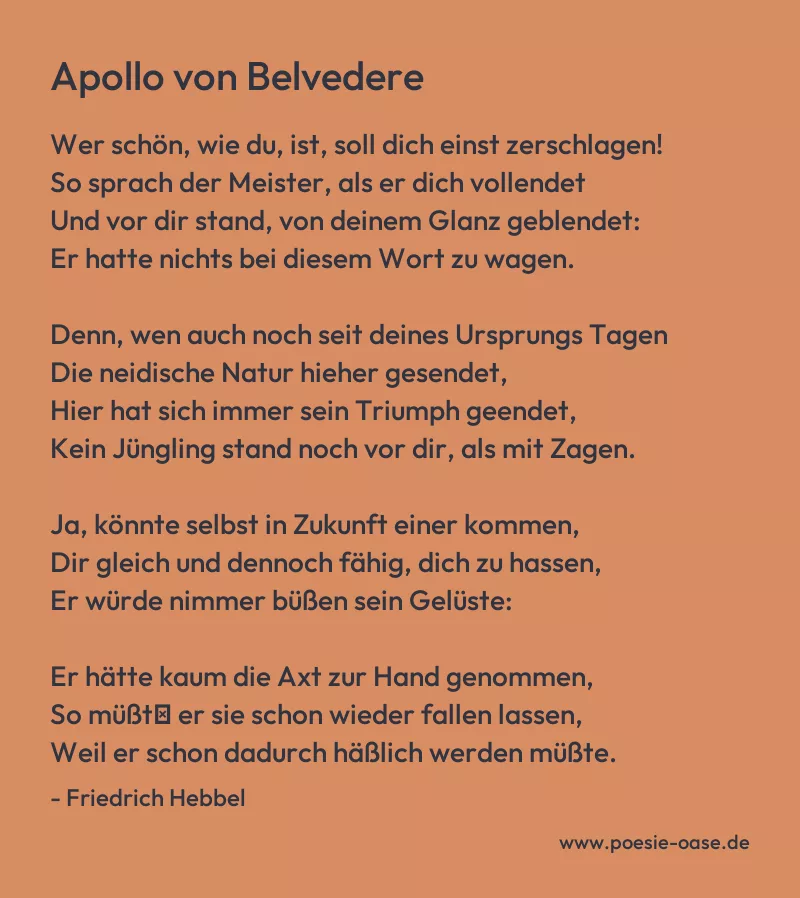Apollo von Belvedere
Wer schön, wie du, ist, soll dich einst zerschlagen!
So sprach der Meister, als er dich vollendet
Und vor dir stand, von deinem Glanz geblendet:
Er hatte nichts bei diesem Wort zu wagen.
Denn, wen auch noch seit deines Ursprungs Tagen
Die neidische Natur hieher gesendet,
Hier hat sich immer sein Triumph geendet,
Kein Jüngling stand noch vor dir, als mit Zagen.
Ja, könnte selbst in Zukunft einer kommen,
Dir gleich und dennoch fähig, dich zu hassen,
Er würde nimmer büßen sein Gelüste:
Er hätte kaum die Axt zur Hand genommen,
So müßt′ er sie schon wieder fallen lassen,
Weil er schon dadurch häßlich werden müßte.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
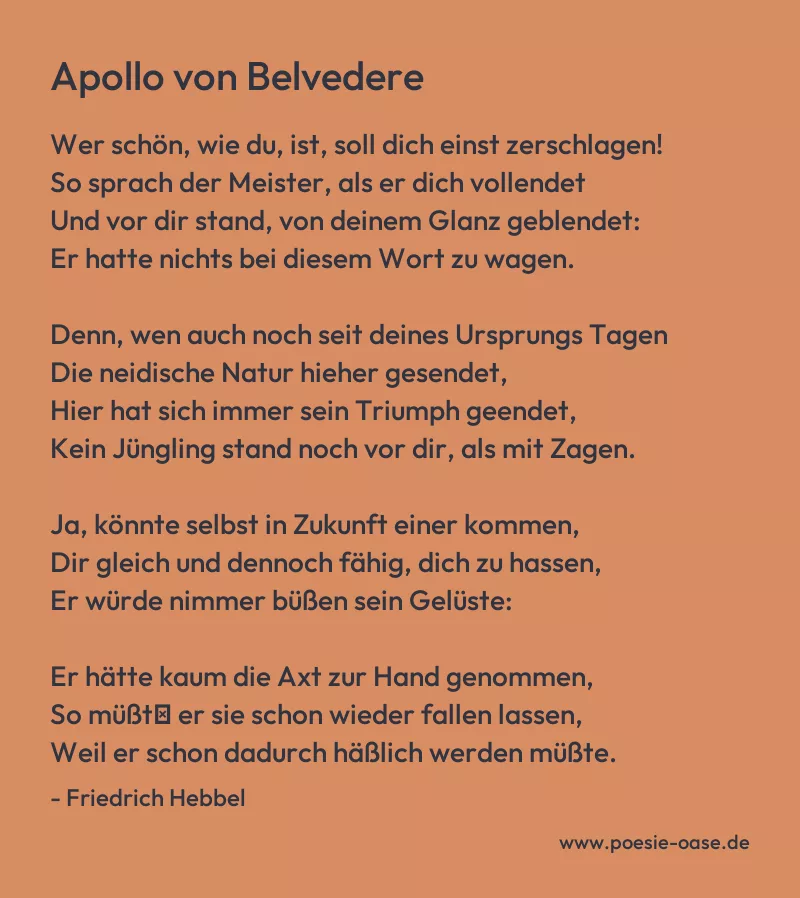
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Apollo von Belvedere“ von Friedrich Hebbel thematisiert die paradoxe Beziehung zwischen Schönheit, Schöpfung und Zerstörung, verpackt in einer Reflexion über die Unvergänglichkeit und gleichzeitige potenzielle Vergänglichkeit des Schönen. Es nimmt Bezug auf die berühmte antike Statue des Apoll von Belvedere, die als Inbegriff klassischer Schönheit gilt. Der Dichter lässt den Bildhauer des Apollo selbst zu Wort kommen und prognostiziert eine zukünftige Zerstörung des Kunstwerks, eine Vorstellung, die durch die ambivalente Natur der Schönheit und des menschlichen Begehrens genährt wird.
Die ersten vier Verse etablieren die Ausgangssituation: Der Meister, überwältigt von der Schönheit seiner vollendeten Schöpfung, spricht den prophetischen Satz aus, dass der Apollo dereinst zerstört werden soll. Die Aussage ist ein Ausdruck der Erkenntnis, dass Vollkommenheit und Schönheit eine Anziehungskraft ausüben, die auch Zerstörung nach sich ziehen kann. Gleichzeitig deutet der Satz die Überlegenheit des Apoll gegenüber jeglicher zukünftiger Schönheit an, was die Unfähigkeit des Menschen, das Schöne zu übertreffen, andeutet. Die zweite Strophe verstärkt diese Idee, indem sie betont, dass noch niemand, der die Statue nach ihrer Entstehung betrachtet hat, diesem Triumph widerstehen konnte. Die Schönheit des Apoll erzeugt Ehrfurcht und Respekt, was die Vorstellung von Zerstörung noch unwahrscheinlicher macht.
Die dritte Strophe bringt jedoch die eigentliche Pointe des Gedichts hervor. Sie spekuliert über die hypothetische Möglichkeit, dass jemand, der dem Apoll ebenbürtig ist, ihn zerstören könnte. Doch selbst ein solcher potenzieller Zerstörer wäre zum Scheitern verurteilt, denn schon die Absicht, die Statue zu beschädigen, würde ihn in den Augen des Dichters entstellen, ihn hässlich machen. Die Aussage deutet auf die Unvereinbarkeit von Zerstörung und ästhetischer Wertschätzung hin. Wer die Schönheit erfasst, kann sie nicht vernichten, ohne sich selbst zu beschädigen.
Hebbel stellt mit diesem Gedicht die Frage nach dem Verhältnis von Schönheit, Macht und Vergänglichkeit. Die Schönheit des Apoll scheint unantastbar, aber die Vorhersage des Meisters wirft einen Schatten auf diese Unzerstörbarkeit. Das Gedicht ergründet die menschliche Ambivalenz gegenüber dem Schönen, die Zuneigung und Ehrfurcht, aber auch das potenzielle Verlangen nach Zerstörung. Die zentrale Aussage des Gedichts liegt darin, dass wahre Schönheit untrennbar mit ihrer eigenen Unantastbarkeit verbunden ist, da jede Handlung, die sie zerstören will, letztendlich scheitern muss, indem sie den Akteur selbst entstellt. Die abschließende Zeile „Weil er schon dadurch häßlich werden müßte“ ist somit nicht nur eine Feststellung, sondern eine tiefgründige Erkenntnis über die Natur der Schönheit und ihre Verbindung zur menschlichen Seele.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.