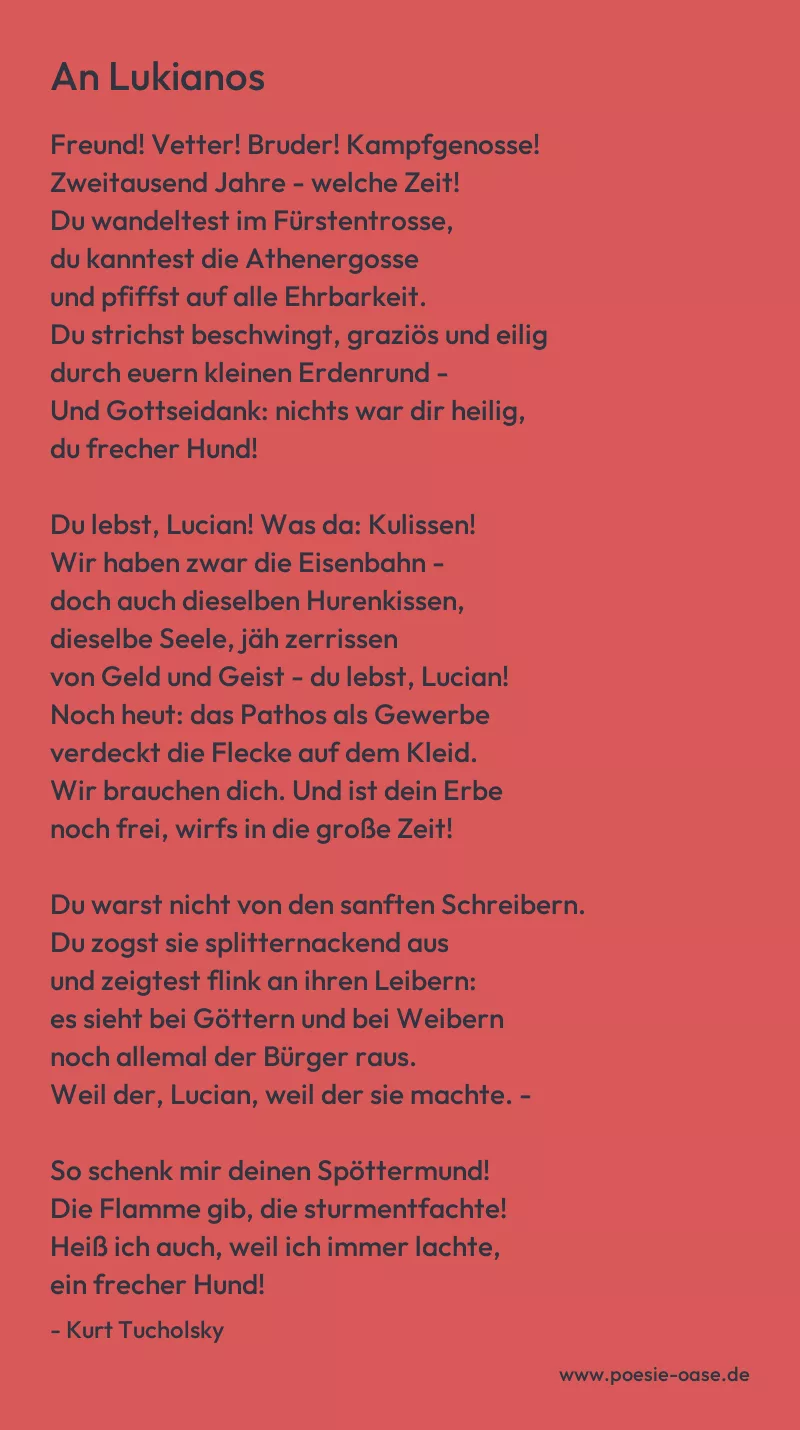An Lukianos
Freund! Vetter! Bruder! Kampfgenosse!
Zweitausend Jahre – welche Zeit!
Du wandeltest im Fürstentrosse,
du kanntest die Athenergosse
und pfiffst auf alle Ehrbarkeit.
Du strichst beschwingt, graziös und eilig
durch euern kleinen Erdenrund –
Und Gottseidank: nichts war dir heilig,
du frecher Hund!
Du lebst, Lucian! Was da: Kulissen!
Wir haben zwar die Eisenbahn –
doch auch dieselben Hurenkissen,
dieselbe Seele, jäh zerrissen
von Geld und Geist – du lebst, Lucian!
Noch heut: das Pathos als Gewerbe
verdeckt die Flecke auf dem Kleid.
Wir brauchen dich. Und ist dein Erbe
noch frei, wirfs in die große Zeit!
Du warst nicht von den sanften Schreibern.
Du zogst sie splitternackend aus
und zeigtest flink an ihren Leibern:
es sieht bei Göttern und bei Weibern
noch allemal der Bürger raus.
Weil der, Lucian, weil der sie machte. –
So schenk mir deinen Spöttermund!
Die Flamme gib, die sturmentfachte!
Heiß ich auch, weil ich immer lachte,
ein frecher Hund!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
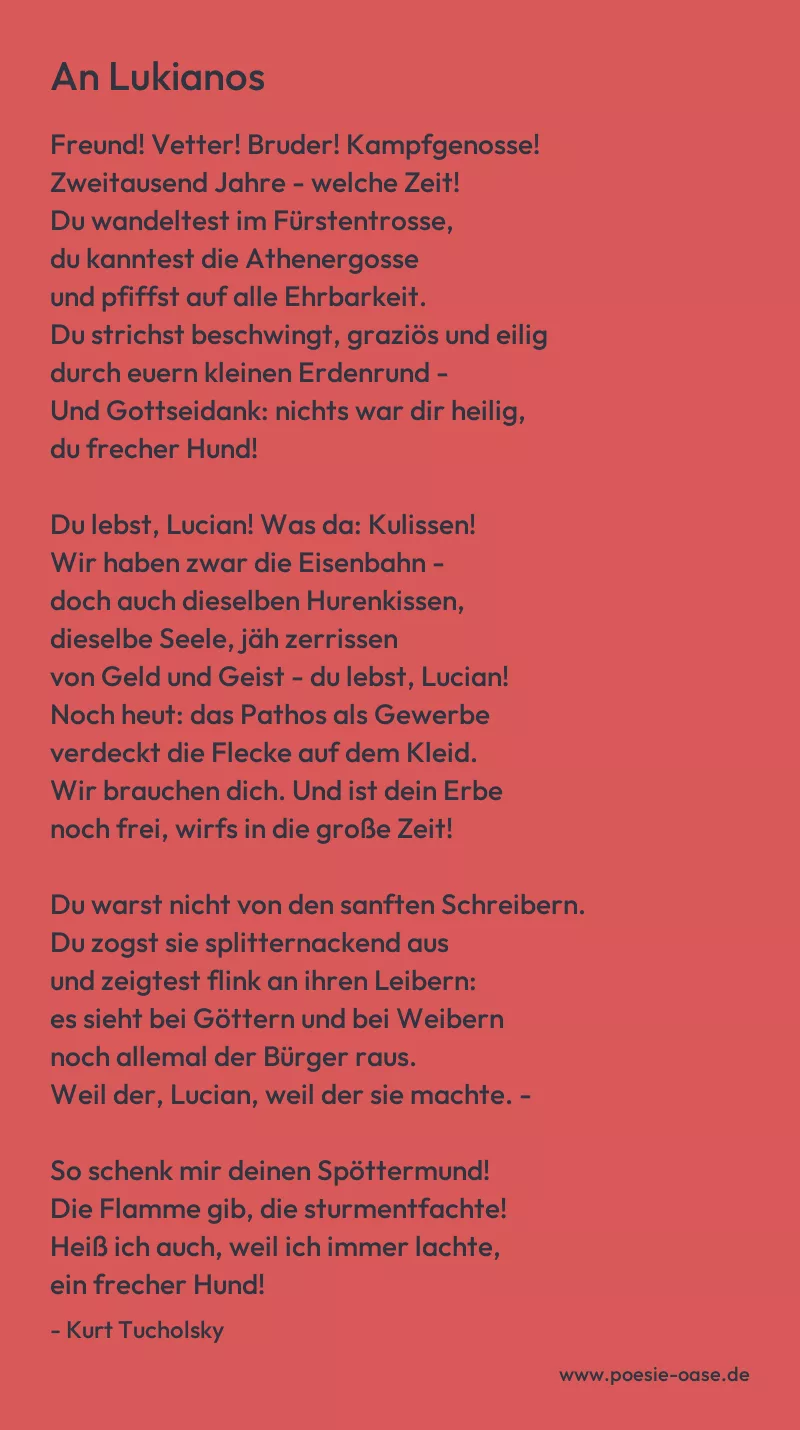
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Lukianos“ von Kurt Tucholsky ist eine Hommage an den antiken Satiriker Lukian von Samosata, eine literarische Figur, die Tucholsky als Verbündeten im Kampf gegen Heuchelei und Korruption sieht. Das Gedicht ist eine kraftvolle Beschwörung des Geistes der Kritik und des Spottes, die die Unveränderlichkeit menschlicher Schwächen über die Jahrtausende hinweg hervorhebt. Tucholsky verbindet dabei die Vergangenheit mit der Gegenwart und sieht in Lukian ein Vorbild für seine eigene Arbeit.
Tucholsky beginnt mit einer direkten Ansprache an Lukian, wobei er ihn als „Freund! Vetter! Bruder! Kampfgenosse!“ bezeichnet, um eine enge Verbindung und gemeinsame Werte zu betonen. Die Verwendung von Worten wie „zweitausend Jahre“ unterstreicht die Zeitlosigkeit des Themas und die Kontinuität menschlicher Mängel. Die Zeilen beschreiben Lukian als jemanden, der sich durch die Gesellschaft bewegte, die „Athenergosse“ kannte und die gängigen Konventionen und „Ehrbarkeit“ verachtete. Diese Beschreibung dient dazu, Lukians Rolle als unerschrockenen Kritiker zu etablieren. Der Ausdruck „frecher Hund!“ wird sowohl für Lukian als auch am Ende des Gedichtes für Tucholsky selbst verwendet und verweist auf die gemeinsame Haltung des Spottes und der ungezügelten Kritik an Missständen.
Im zweiten Teil des Gedichts stellt Tucholsky Parallelen zwischen Lukians Zeit und der eigenen Gegenwart her. Er argumentiert, dass trotz der Fortschritte, wie der „Eisenbahn“, die menschlichen Probleme, wie „Hurenkissen“ und die Zerrissenheit der Seele durch „Geld und Geist“, im Wesentlichen dieselben geblieben sind. Das „Pathos als Gewerbe“, also die Instrumentalisierung von Emotionen und Idealen für kommerzielle Zwecke, ist ein weiteres Indiz für die gesellschaftliche Scheinheiligkeit, die er anprangert. Der Ruf nach Lukian als „frecher Hund“ impliziert die Notwendigkeit von Kritik und Spott als Mittel, um gesellschaftliche Missstände aufzudecken und zu bekämpfen.
Das Gedicht endet mit einem direkten Appell an Lukian, mit der Bitte um die „Flamme“, die er entfacht hat. Tucholsky wünscht sich Lukians Spott, seine Fähigkeit, die Dinge schonungslos zu benennen und die Fassaden zu durchbrechen. Die Schlusszeile, in der er sich selbst als „frecher Hund!“ bezeichnet, verbindet ihn endgültig mit seinem Vorbild. Es ist ein Bekenntnis zur gleichen rebellischen Haltung und der Bereitschaft, gegen die Konventionen anzukämpfen. Das Gedicht ist somit eine Ode an den Geist der Satire und ein Aufruf zur kritischen Auseinandersetzung mit der Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.