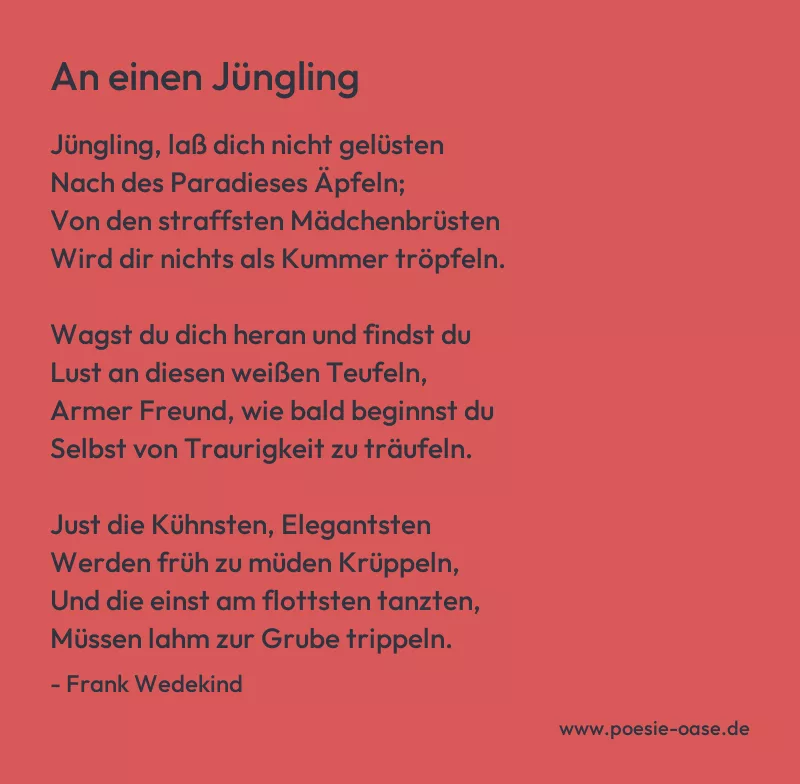An einen Jüngling
Jüngling, laß dich nicht gelüsten
Nach des Paradieses Äpfeln;
Von den straffsten Mädchenbrüsten
Wird dir nichts als Kummer tröpfeln.
Wagst du dich heran und findst du
Lust an diesen weißen Teufeln,
Armer Freund, wie bald beginnst du
Selbst von Traurigkeit zu träufeln.
Just die Kühnsten, Elegantsten
Werden früh zu müden Krüppeln,
Und die einst am flottsten tanzten,
Müssen lahm zur Grube trippeln.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
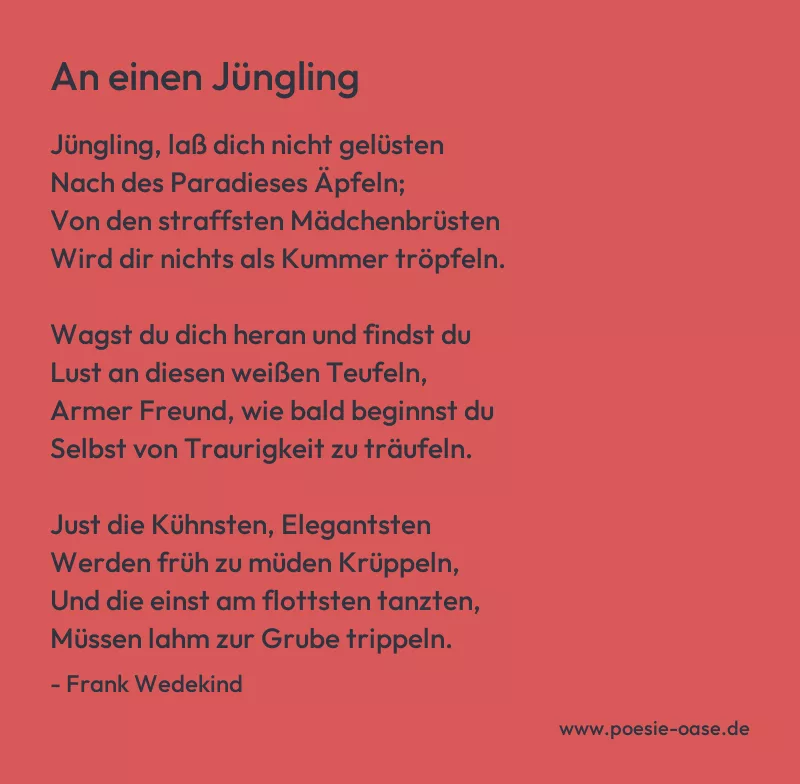
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einen Jüngling“ von Frank Wedekind ist eine warnende Mahnung an junge Männer, sich nicht von den Verlockungen der körperlichen Liebe blenden zu lassen. Es beginnt mit einem direkten Appell: „Jüngling, laß dich nicht gelüsten / Nach des Paradieses Äpfeln“, wobei die Äpfel hier als Metapher für die erotische Anziehungskraft und die damit verbundenen Freuden stehen. Die ersten beiden Verse etablieren das zentrale Thema des Gedichts: Die vermeintlichen Freuden der Liebe führen letztlich zu Leid und Kummer.
Im zweiten Teil vertieft Wedekind diese Warnung. Durch rhetorische Fragen und die Verwendung von Begriffen wie „weiße Teufel“ werden die Frauen, oder zumindest die Vorstellung von erotischer Leidenschaft, dämonisiert. Die Anziehungskraft, die von den „straffsten Mädchenbrüsten“ ausgeht, wird als trügerisch dargestellt, denn wer sich ihr hingibt, wird unweigerlich Unglück erfahren. Die Zeilen „Armer Freund, wie bald beginnst du / Selbst von Traurigkeit zu träufeln“ unterstreichen die Kürze und Intensität des Kummers, der auf die anfängliche Lust folgt.
Der dritte und letzte Abschnitt des Gedichts verstärkt das düstere Bild der Zukunft, die junge Männer erwartet, die sich von der Liebe verführen lassen. Wedekind malt ein Bild der Verfalls, des Verlusts von Jugend und Energie. Die einst „Kühnsten, Elegantsten“ werden zu „müden Krüppeln“, und diejenigen, die einst „am flottsten tanzten“, müssen „lahm zur Grube trippeln“. Diese abschließenden Verse sind eine drastische Übertreibung, die jedoch die Botschaft des Gedichts verdeutlichen: Die kurzlebige Freude der körperlichen Liebe führt zu physischem und emotionalem Verfall.
Die Sprache Wedekinds ist prägnant und direkt, mit einem Anflug von Ironie und Zynismus. Die gewählten Worte sind bewusst provozierend, wie die Verwendung des Wortes „Teufel“ zur Beschreibung von Frauen zeigt. Der Reim, der in dem Gedicht durchgehend verwendet wird, verleiht ihm eine rhythmische Qualität, die die düstere Botschaft umso eindringlicher macht. Wedekind scheint hier eine Warnung vor der Oberflächlichkeit und den kurzlebigen Freuden der erotischen Leidenschaft zu formulieren, indem er eine pessimistische Sicht auf die Auswirkungen auf die menschliche Existenz einnimmt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.