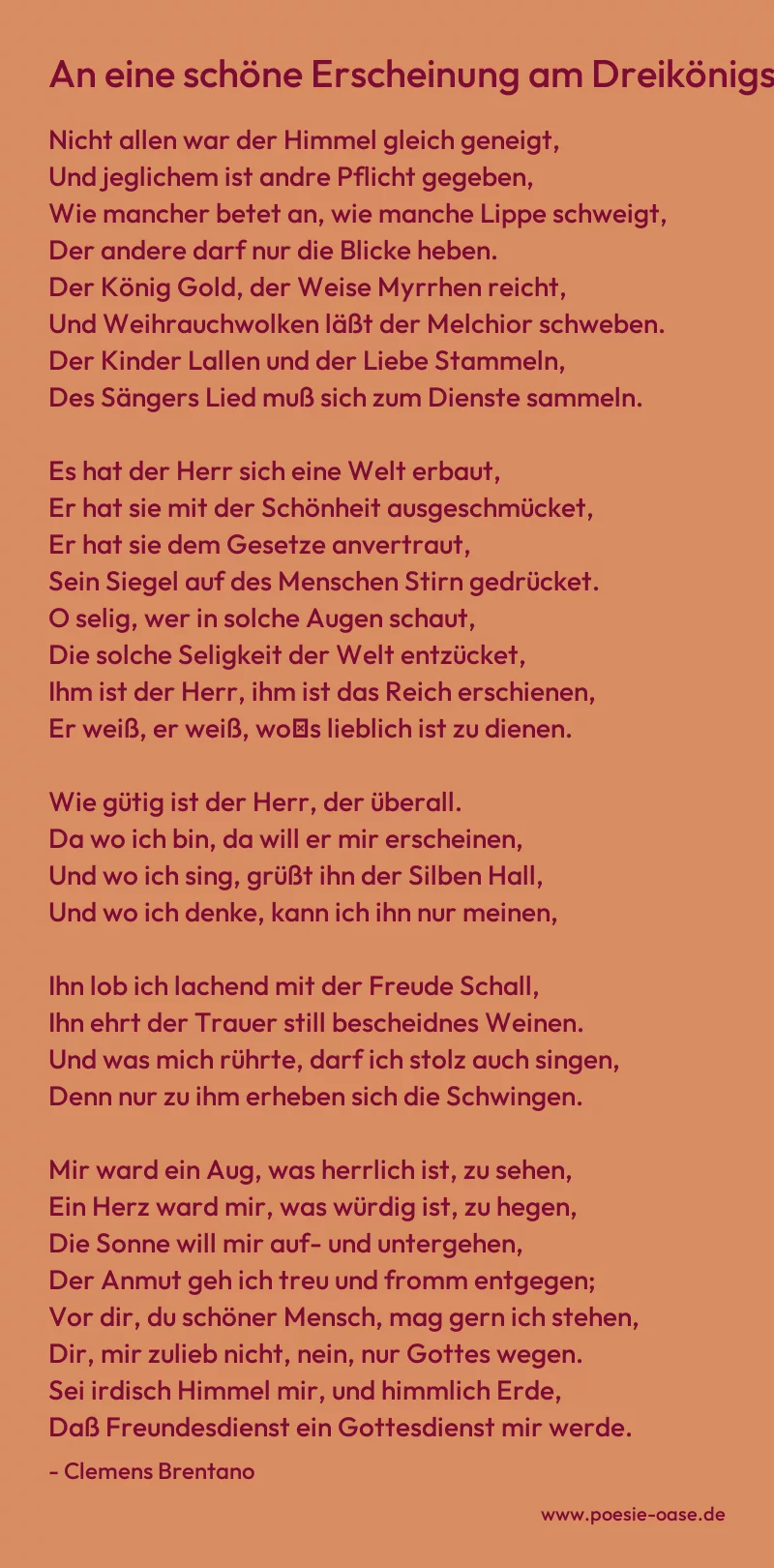Nicht allen war der Himmel gleich geneigt,
Und jeglichem ist andre Pflicht gegeben,
Wie mancher betet an, wie manche Lippe schweigt,
Der andere darf nur die Blicke heben.
Der König Gold, der Weise Myrrhen reicht,
Und Weihrauchwolken läßt der Melchior schweben.
Der Kinder Lallen und der Liebe Stammeln,
Des Sängers Lied muß sich zum Dienste sammeln.
Es hat der Herr sich eine Welt erbaut,
Er hat sie mit der Schönheit ausgeschmücket,
Er hat sie dem Gesetze anvertraut,
Sein Siegel auf des Menschen Stirn gedrücket.
O selig, wer in solche Augen schaut,
Die solche Seligkeit der Welt entzücket,
Ihm ist der Herr, ihm ist das Reich erschienen,
Er weiß, er weiß, wo′s lieblich ist zu dienen.
Wie gütig ist der Herr, der überall.
Da wo ich bin, da will er mir erscheinen,
Und wo ich sing, grüßt ihn der Silben Hall,
Und wo ich denke, kann ich ihn nur meinen,
Ihn lob ich lachend mit der Freude Schall,
Ihn ehrt der Trauer still bescheidnes Weinen.
Und was mich rührte, darf ich stolz auch singen,
Denn nur zu ihm erheben sich die Schwingen.
Mir ward ein Aug, was herrlich ist, zu sehen,
Ein Herz ward mir, was würdig ist, zu hegen,
Die Sonne will mir auf- und untergehen,
Der Anmut geh ich treu und fromm entgegen;
Vor dir, du schöner Mensch, mag gern ich stehen,
Dir, mir zulieb nicht, nein, nur Gottes wegen.
Sei irdisch Himmel mir, und himmlich Erde,
Daß Freundesdienst ein Gottesdienst mir werde.