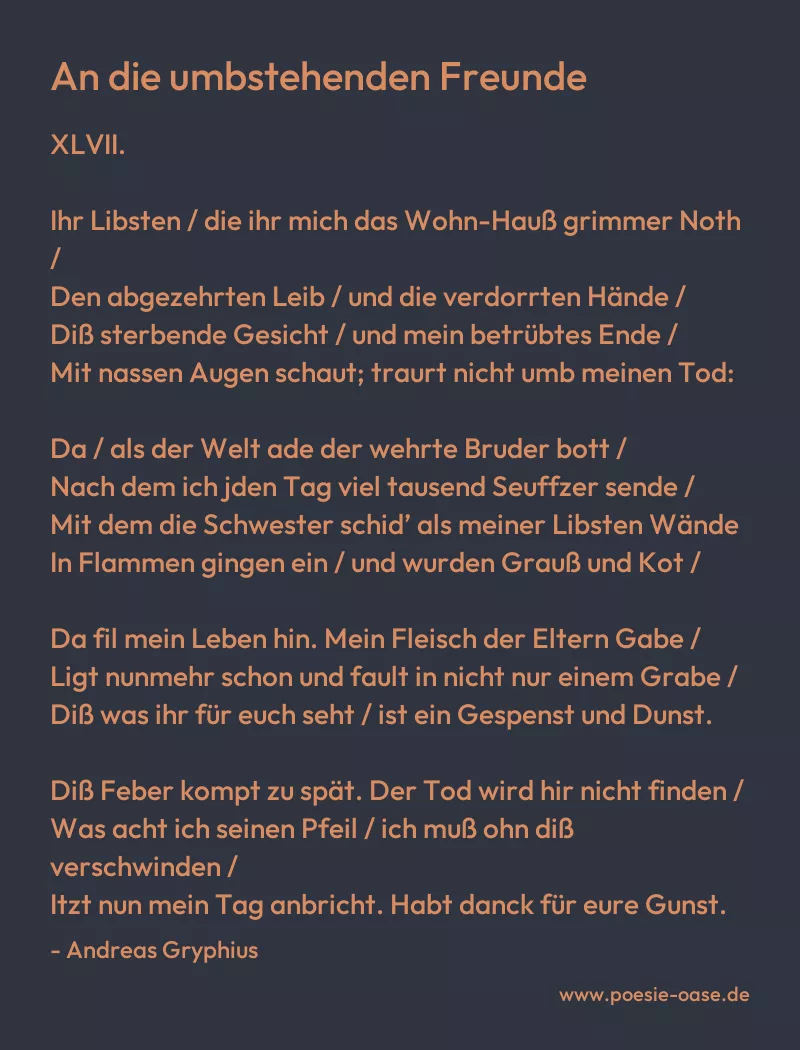An die umbstehenden Freunde
XLVII.
Ihr Libsten / die ihr mich das Wohn-Hauß grimmer Noth /
Den abgezehrten Leib / und die verdorrten Hände /
Diß sterbende Gesicht / und mein betrübtes Ende /
Mit nassen Augen schaut; traurt nicht umb meinen Tod:
Da / als der Welt ade der wehrte Bruder bott /
Nach dem ich jden Tag viel tausend Seuffzer sende /
Mit dem die Schwester schid’ als meiner Libsten Wände
In Flammen gingen ein / und wurden Grauß und Kot /
Da fil mein Leben hin. Mein Fleisch der Eltern Gabe /
Ligt nunmehr schon und fault in nicht nur einem Grabe /
Diß was ihr für euch seht / ist ein Gespenst und Dunst.
Diß Feber kompt zu spät. Der Tod wird hir nicht finden /
Was acht ich seinen Pfeil / ich muß ohn diß verschwinden /
Itzt nun mein Tag anbricht. Habt danck für eure Gunst.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
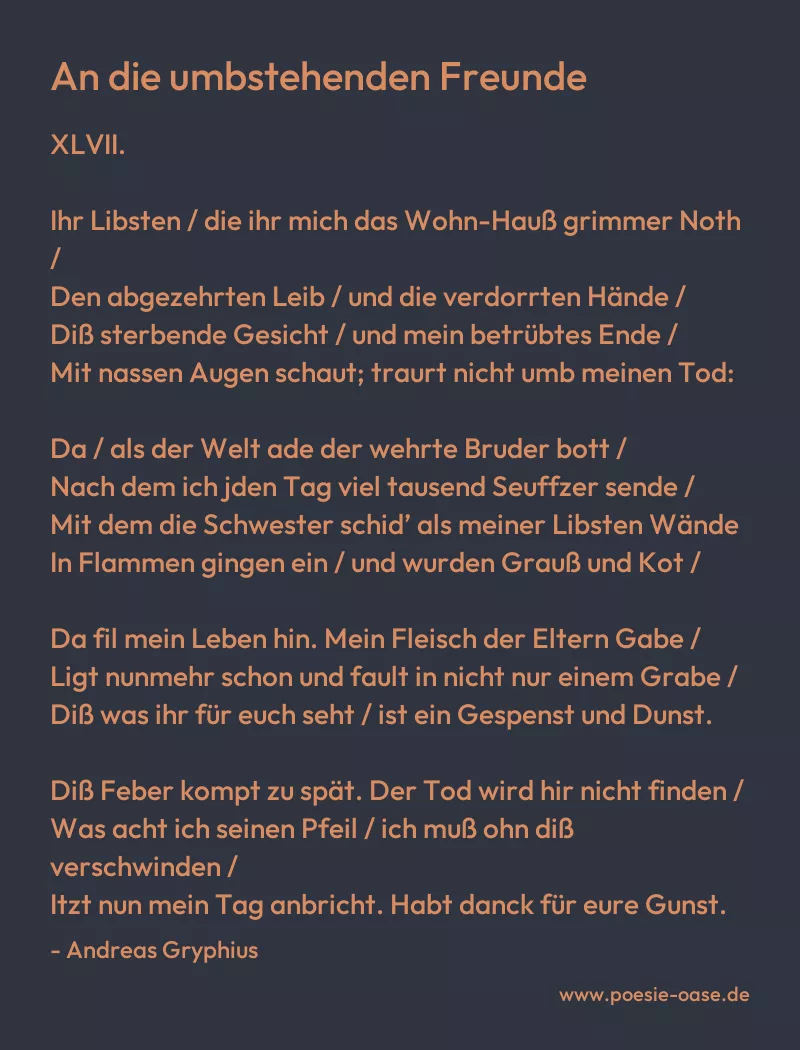
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die umbstehenden Freunde“ von Andreas Gryphius, verfasst in der Zeit des Barock, ist eine bewegende Auseinandersetzung mit dem Tod und der Auflösung des irdischen Daseins. Der Dichter wendet sich an seine Freunde, die Zeugen seines körperlichen Verfalls und seines nahenden Todes sind, und tröstet sie, indem er die Vergänglichkeit des Lebens thematisiert und die Erlösung im Jenseits in den Vordergrund rückt.
Gryphius beginnt mit der Beschreibung seines physischen Zustands – „das Wohn-Hauß grimmer Noth“, „abgezehrten Leib“, „verdorrten Hände“, „sterbende Gesicht“ – um die Schwere seines Leidens zu verdeutlichen. Er fordert die Freunde auf, nicht um seinen Tod zu trauern, da sein eigentliches Leben bereits früher, durch erlittenes Leid und den Verlust geliebter Menschen, beendet wurde. Dies deutet auf eine tiefe persönliche Erfahrung hin, die den Dichter in seinem Leben stark beeinflusst hat. Insbesondere der Verlust von Bruder und Schwester, sowie die Zerstörung von etwas Liebem („Libsten Wände in Flammen gingen ein“), scheinen den Schmerz nochmals zu verstärken.
Der Dichter beschreibt seine leibliche Existenz, als etwas Verwelktes und Verfallenes („Mein Fleisch der Eltern Gabe / Ligt nunmehr schon und fault“). Das, was seine Freunde jetzt sehen, ist nur noch ein „Gespenst und Dunst“, ein Überbleibsel, das der Seele nicht mehr gerecht wird. Diese Aussage unterstreicht die barocke Vorstellung von der Vanitas, der Vergänglichkeit alles Irdischen. Der Tod, so Gryphius, ist in seiner gegenwärtigen Situation irrelevant, da er bereits im Geiste gestorben ist.
Die letzten Verse des Gedichts sind von einer gewissen Erleichterung geprägt. Der Dichter deutet auf die Ankunft eines neuen Tages, des ewigen Lebens, hin. Er bedankt sich für die Zuneigung und Gunst seiner Freunde und bereitet sich auf das Sterben vor. Der Tod wird hier nicht als Schrecken, sondern als Befreiung und Übergang in eine neue, bessere Existenz betrachtet. Gryphius‘ Werk ist somit nicht nur eine Klage über den Tod, sondern auch ein Trostspruch, der die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod in den Mittelpunkt rückt und die Vergänglichkeit des irdischen Lebens relativiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.