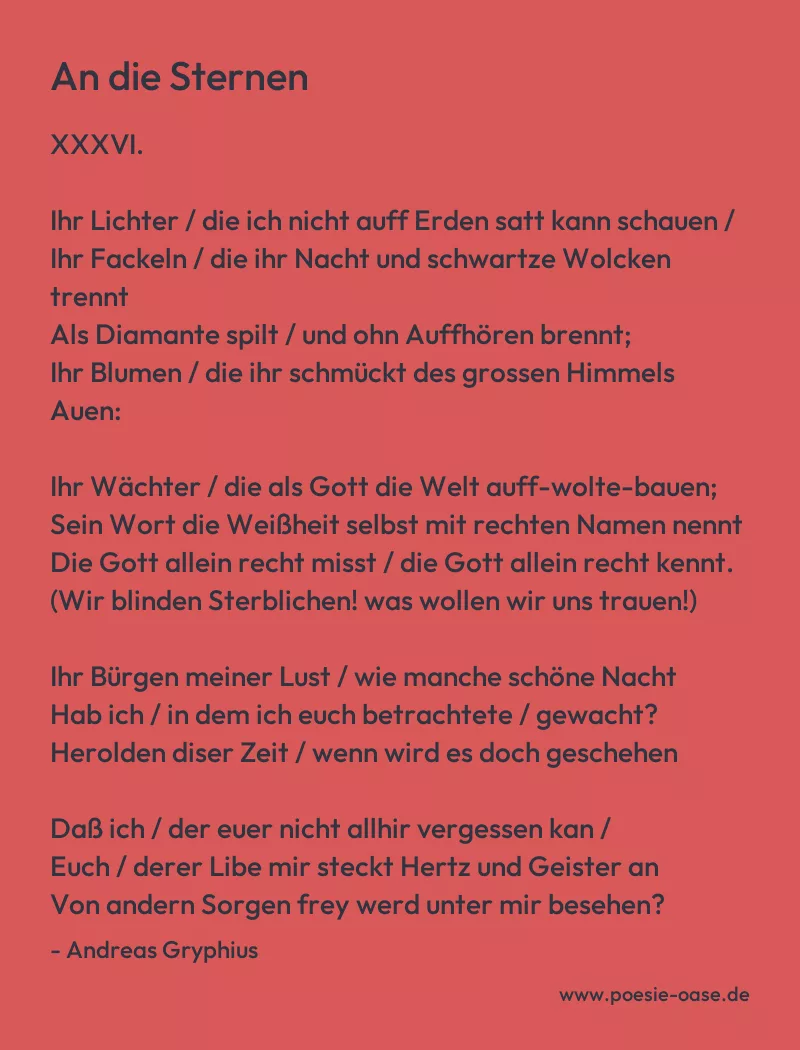An die Sternen
XXXVI.
Ihr Lichter / die ich nicht auff Erden satt kann schauen /
Ihr Fackeln / die ihr Nacht und schwartze Wolcken trennt
Als Diamante spilt / und ohn Auffhören brennt;
Ihr Blumen / die ihr schmückt des grossen Himmels Auen:
Ihr Wächter / die als Gott die Welt auff-wolte-bauen;
Sein Wort die Weißheit selbst mit rechten Namen nennt
Die Gott allein recht misst / die Gott allein recht kennt.
(Wir blinden Sterblichen! was wollen wir uns trauen!)
Ihr Bürgen meiner Lust / wie manche schöne Nacht
Hab ich / in dem ich euch betrachtete / gewacht?
Herolden diser Zeit / wenn wird es doch geschehen
Daß ich / der euer nicht allhir vergessen kan /
Euch / derer Libe mir steckt Hertz und Geister an
Von andern Sorgen frey werd unter mir besehen?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
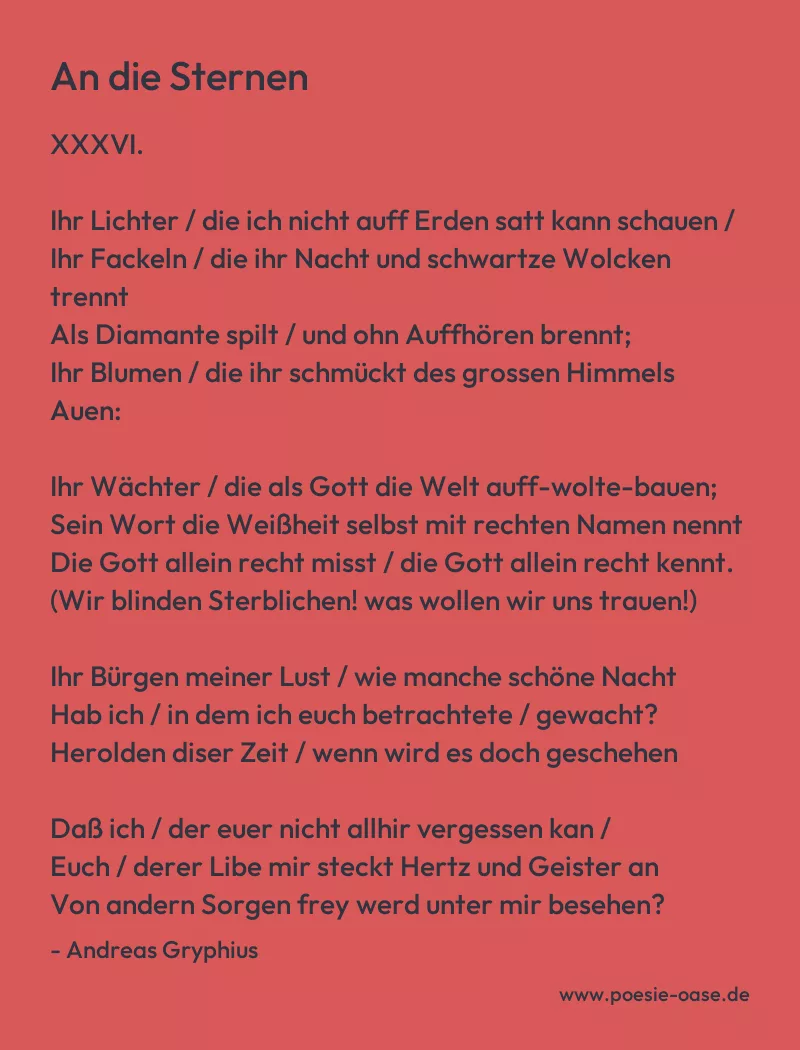
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Sternen“ von Andreas Gryphius ist eine tiefgründige Reflexion über die Schönheit und das Geheimnis des Himmels sowie die menschliche Sehnsucht nach Erkenntnis und Trost. Gryphius, ein bedeutender Dichter des Barock, verwendet in diesem Sonett eine kunstvolle Sprache und reiche Bilder, um seine Bewunderung für die Sterne auszudrücken und die Begrenzung des menschlichen Verständnisses zu thematisieren. Die einleitenden Verse preisen die Sterne als leuchtende, unvergängliche Wesen, die die Dunkelheit erhellen und den Himmel schmücken.
Der zweite Teil des Gedichts wendet sich von der reinen Bewunderung dem Nachdenken über die Rolle der Sterne in der göttlichen Ordnung zu. Gryphius beschreibt sie als „Wächter“, die bei der Erschaffung der Welt durch Gott anwesend waren. Durch diese Metapher wird eine Verbindung zwischen den Sternen, der göttlichen Weisheit und der Unkenntnis der sterblichen Menschen hergestellt. Der Dichter erkennt die Grenzen menschlichen Wissens und stellt die Frage nach der Anmaßung des Menschen, die göttliche Ordnung verstehen zu wollen. Die Klammerbemerkung „(Wir blinden Sterblichen! was wollen wir uns trauen!)“ unterstreicht diese Demut und die Erkenntnis der menschlichen Beschränktheit.
In den letzten sechs Versen wird die persönliche Beziehung des Dichters zu den Sternen deutlich. Er beschreibt die Nächte, die er mit der Betrachtung der Sterne verbracht hat, und drückt seine Sehnsucht nach einer dauerhaften Verbindung zu ihnen aus. Die Sterne werden zu „Bürgen meiner Lust“ und wecken eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit von irdischen Sorgen. Gryphius sehnt sich nach dem Moment, in dem er die Sterne betrachten kann, ohne von weltlichen Dingen abgelenkt zu werden. Diese Zeilen offenbaren eine tiefe Sehnsucht nach spiritueller Erhebung und nach dem Verständnis des Göttlichen, das sich in den Sternen manifestiert.
Insgesamt ist „An die Sternen“ ein Beispiel für die barocke Sehnsucht nach Transzendenz und die gleichzeitige Auseinandersetzung mit den Grenzen des menschlichen Wissens. Das Gedicht vereint die Bewunderung der Schönheit des Himmels mit der Demut vor der göttlichen Ordnung und der Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit. Gryphius‘ Sprache ist reich an Bildern und Metaphern, die die Leser in eine Welt der Ehrfurcht und der stillen Kontemplation entführen und zur Reflexion über die eigene Existenz anregen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.