Du, die das Unglück mit der Grazie Schritten,
Auf jungen Schultern, herrlich jüngsthin trug:
Wie wunderbar ist meine Brust verwirrt,
In diesem Augenblick, da ich auf Knieen,
Um dich zu segnen, vor dir niedersinke.
Ich soll dir ungetrübte Tag′ erflehn:
Dir, die der hohen Himmelssonne gleich,
In voller Pracht nur strahlt und Herrlichkeit,
Wenn sie durch finstre Wetterwolken bricht.
O du, die aus dem Kampf empörter Zeit,
Die einzge Siegerin, hervorgegangen:
Was für ein Wort, dein würdig, sag ich dir?
So zieht ein Cherub, mit gespreizten Flügeln,
Zur Nachtzeit durch die Luft, und, auf den Rücken
Geworfen, staunen ihn, von Glanz geblendet,
Der Welt betroffene Geschlechter an.
Wir alle mögen, Hoh′ und Niedere,
Von den Ruinen unsers Glücks umgeben,
Gebeugt von Schmerz, die Himmlischen verklagen,
Doch du Erhabene, du darfst es nicht!
Denn eine Glorie, in jenen Nächten,
Umglänzte deine Stirn, von der die Welt
Am lichten Tag der Freude nichts geahnt:
Wir sahn dich Anmut endlos niederregnen,
Daß du so groß als schön warst, war uns fremd!
Viel Blumen blühen in dem Schoß der Deinen
Noch deinem Gurt zum Strauß, und du bists wert,
Doch eine schönre Palm erringst du nicht!
Und würde dir, durch einen Schluß der Zeiten
Die Krone auch der Welt: die goldenste,
Die dich zur Königin der Erde macht,
Hat still die Tugend schon dir aufgedrückt.
Sei Teure, lange noch des Landes Stolz,
Durch frohe Jahre, wie, durch frohe Jahre,
Du seine Lust und sein Entzücken warst!
An die Königin Luise von Preussen (2. Fassung)
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
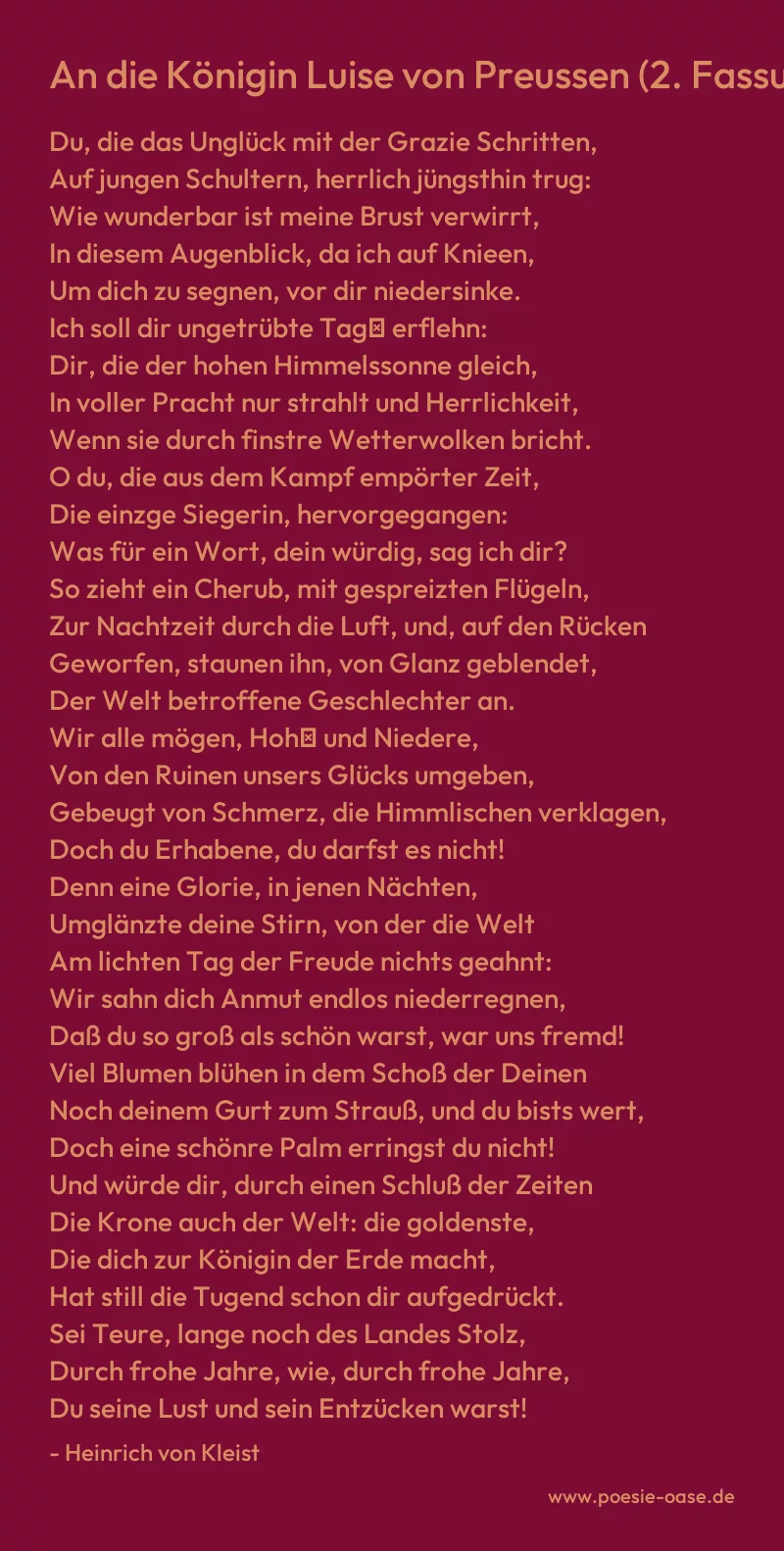
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Königin Luise von Preussen (2. Fassung)“ von Heinrich von Kleist ist eine Huldigung an die preußische Königin Luise, die in einer Zeit großer politischer und persönlicher Not ihre Würde und Stärke bewies. Das Gedicht entstand im Kontext der Napoleonischen Kriege, in denen Preußen schwere Niederlagen erlitt. Kleist wählt eine pathetische und bewundernde Sprache, um Luise als leuchtendes Vorbild inmitten von Leid und Unglück zu preisen. Der erste Teil des Gedichts beschreibt Luise als diejenige, die das Unglück mit Anmut erträgt und in ihrer Schönheit strahlt, wie die Sonne, die durch dunkle Wolken bricht.
Kleist vergleicht Luise mit einem Cherub, dessen Glanz die Welt blendet, was ihre außergewöhnliche Fähigkeit, inmitten der Zerstörung Würde zu bewahren, unterstreicht. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass Luise nicht nur durch ihre äußere Erscheinung, sondern vor allem durch ihre innere Stärke und Tugend hervorsticht. Während das Volk durch die Ruinen seines Glücks gebeugt ist und die Götter anklagt, wird Luise als überlegen dargestellt, da sie eine innere Glorie besitzt, die die Welt im Tag der Freude nicht erahnte.
Der zweite Teil des Gedichts hebt die innere Schönheit und Tugend Luises hervor, die sie zu einer moralischen Instanz macht. Kleist betont, dass Luise trotz der widrigen Umstände eine einzigartige und unübertreffliche Palme der Tugend erworben hat, die ihr schon im stillen die Krone aufdrückt. Diese „Krone der Tugend“ ist wichtiger als jede weltliche Herrschaft. Der Autor wünscht ihr ein langes Leben als Stolz des Landes, geprägt von Freude, die sie sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten verkörperte.
Die Sprache des Gedichts ist reich an Bildern und Metaphern. Kleist nutzt Vergleiche mit Naturphänomenen wie der Sonne und dem Cherub, um die erhabene und leuchtende Natur Luisens zu veranschaulichen. Die Verwendung von Pathos und die bewundernde Anrede unterstreichen die Verehrung des Dichters für die Königin. Kleists Gedicht ist somit eine Apotheose, die die Tugend und Stärke Luises in den Mittelpunkt stellt und sie als moralisches Vorbild für das preußische Volk in einer Zeit der Krise verherrlicht.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
