O schöner, blauer Himmel,
Der über mir gewölbet,
Sich in der weiten Ferne
Zur Erde niedersenket,
Warum vermag dein Ende
Ich nie, nie zu erreichen?
Wie oft, auf freier Ebne,
Lief ich aus allen Kräften
Dem Orte zu, wo freundlich
Die Erde du berührest,
Und sah, dort angelanget,
Mich jedesmal getäuschet:
Denn während meines Laufes
Warst mitleidslos du weiter
Gerückt. Wenn du mit mir doch
Verführst, wie manche Mutter,
Die, um ihr träges Kindlein
Zu üben, einen Apfel
Mit rothen Wangen oder
Die honigsüße Birne
Ihm in erhobner Hand zeigt,
Mit Worten es ermunternd.
Das Kind, das Obst zu haschen,
Stellt ein- und zwei- und vielmal
Sich auf die schwachen Füße,
Und zehnmal sind mißlungen
Die eifrigen Versuche.
Da läßt zuletzt die Mutter
Es des Erfolges seiner
Bemühungen sich freuen.
Ich klage nicht darüber,
Daß du das Ziel stets weiter
Und weiter rückest; laß mich
Nur endlich einmal deinen
Anmuth′gen Rand erreichen,
Und in die Wolken steigen,
Die, Hügelreihen ähnlich,
Auf ihm empor sich schichten.
Laß wie in einem Boote
Du mich von ihnen tragen
Von einem Ort zum andern,
Und aus der Luft die Erde
Mich unter mir erblicken
Gleichwie im Vogelfluge.
Sei du nicht bang, o Himmel,
Der Kopf wird mir nicht schwindeln.
Fahr′ ich doch dreist im Kahne
Oft über all den Wundern
Der Wasserwelt, und sehe
In Reihen umgestürzte
Gebäude, Bäume, Thürme
Tief unter mir sich regen.
O laß dich, guter Himmel,
Ein einzig Mal erbitten!
An den Himmel
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
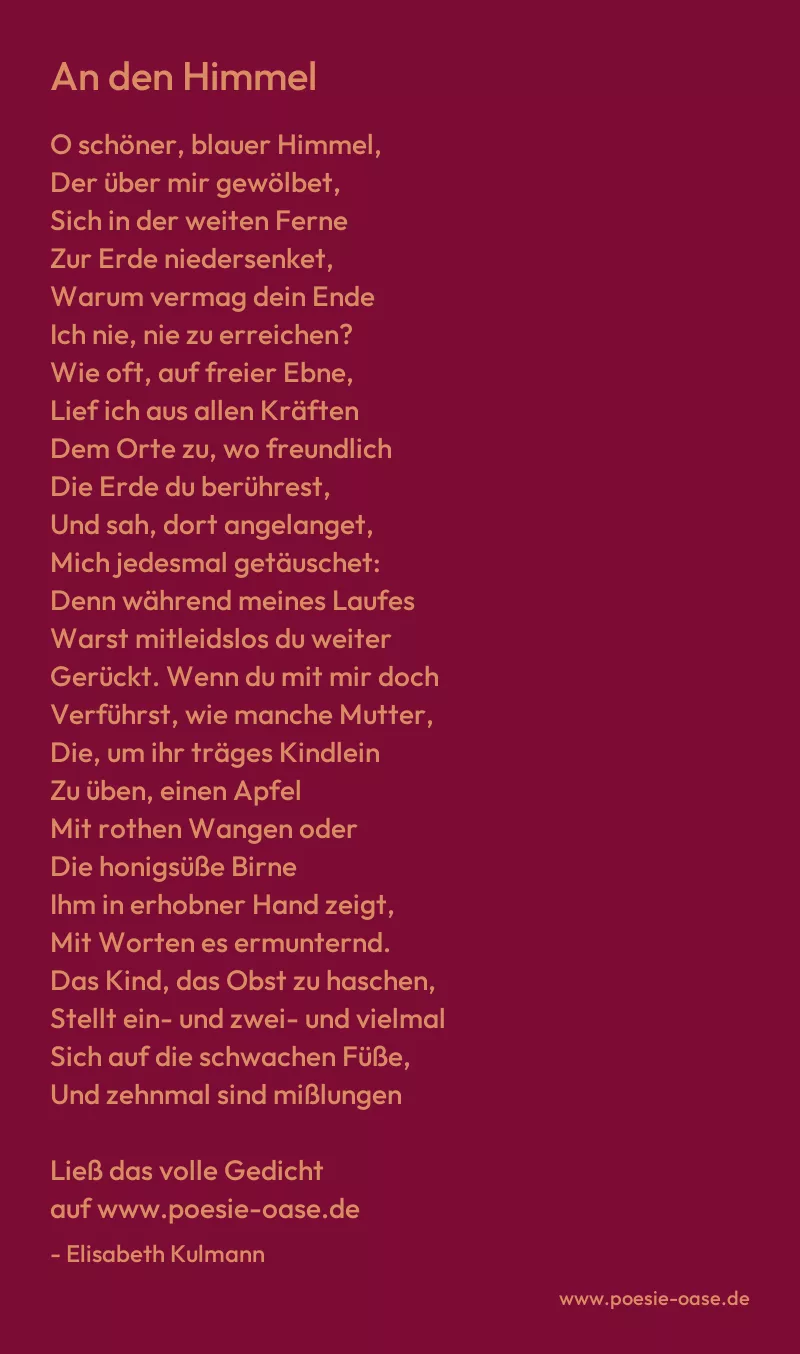
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Himmel“ von Elisabeth Kulmann ist eine sehnsuchtsvolle Auseinandersetzung mit der unerreichbaren Ferne, symbolisiert durch den blauen Himmel. Das lyrische Ich wendet sich direkt an den Himmel und drückt den Wunsch aus, die imaginäre Grenze zwischen Himmel und Erde zu erreichen. Der Text ist von einer kindlichen Naivität und einem ungestillten Verlangen nach Überschreitung der irdischen Grenzen geprägt.
Das Gedicht verwendet eine Reihe von Bildern, um die Unerreichbarkeit des Himmels zu verdeutlichen. Die Metapher der „weiten Ferne“, die sich „zur Erde niedersenket“, erzeugt ein Gefühl der Distanz. Die wiederholten Versuche, das scheinbar greifbare Ziel zu erreichen, scheitern immer wieder, was das lyrische Ich frustriert, aber nicht entmutigt. Der Vergleich mit einer Mutter, die ihr Kind mit einem Apfel oder einer Birne ködert, unterstreicht die spielerische Natur des Verlangens und die Täuschung, die der Himmel ausübt. Der Wunsch, den Rand des Himmels zu erreichen, in die Wolken zu steigen und von ihnen getragen zu werden, offenbart eine Sehnsucht nach Freiheit und Transzendenz.
Die Sprache des Gedichts ist relativ einfach und direkt, was die kindliche Sehnsucht und Unmittelbarkeit des lyrischen Ichs unterstreicht. Die Verwendung von Fragen („Warum vermag dein Ende / Ich nie, nie zu erreichen?“), Appellen („O laß dich, guter Himmel, / Ein einzig Mal erbitten!“) und direkten Anreden („O schöner, blauer Himmel“) schafft eine intime Atmosphäre. Die Wiederholung bestimmter Wörter und Phrasen („nie, nie“, „weiter und weiter“) verstärkt die emotionale Intensität und die Verzweiflung des lyrischen Ichs über die Unerreichbarkeit seines Ziels.
Die im Gedicht zum Ausdruck kommende Sehnsucht nach dem Überschreiten von Grenzen ist mehr als nur ein kindlicher Wunsch nach spielerischer Eroberung. Sie ist Ausdruck einer grundlegenden menschlichen Sehnsucht nach etwas Größerem, nach dem Unbegrenzten, nach der Freiheit von irdischen Beschränkungen. Der Bezug zum Vogelflug und zum Fahren im Kahn über die Wasserwelt verdeutlichen den Wunsch nach einem erweiterten Bewusstsein und der Erfahrung von Weite und Freiheit. Am Ende bleibt das Gedicht als eine eindringliche Reflexion über das Streben nach dem Unendlichen und die Unmöglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ohne dabei seine Faszination zu verlieren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
