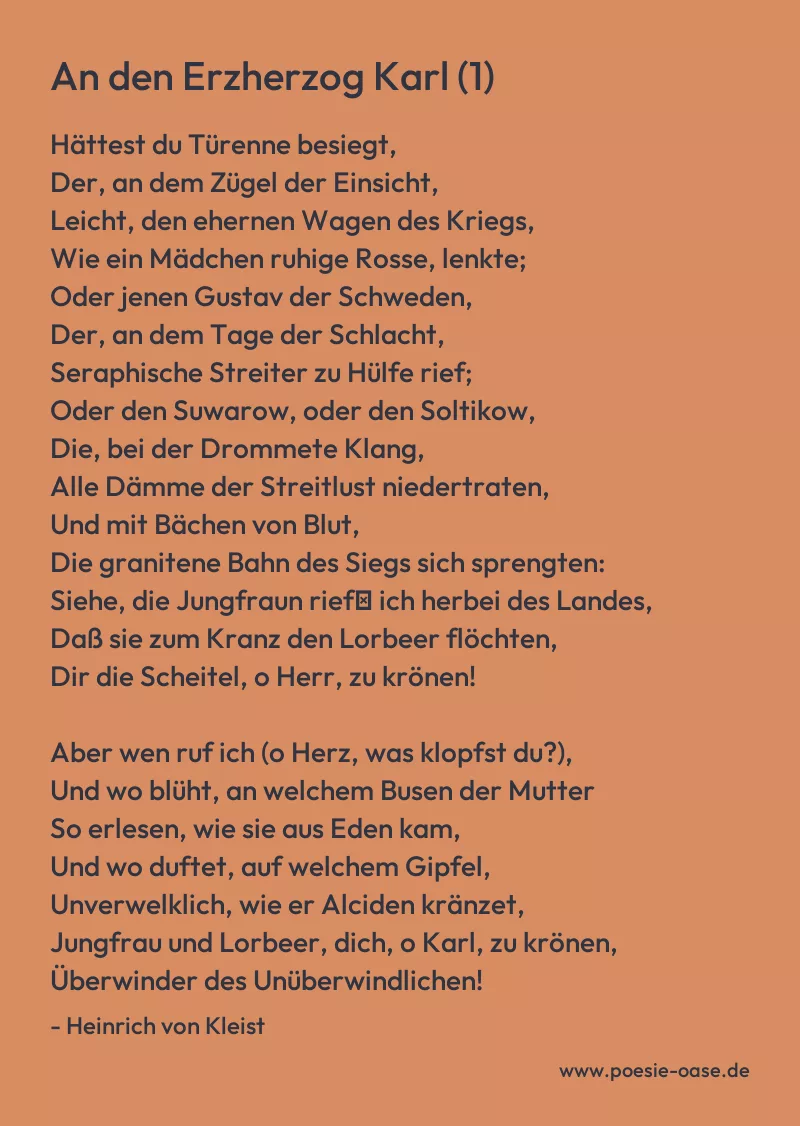An den Erzherzog Karl (1)
Hättest du Türenne besiegt,
Der, an dem Zügel der Einsicht,
Leicht, den ehernen Wagen des Kriegs,
Wie ein Mädchen ruhige Rosse, lenkte;
Oder jenen Gustav der Schweden,
Der, an dem Tage der Schlacht,
Seraphische Streiter zu Hülfe rief;
Oder den Suwarow, oder den Soltikow,
Die, bei der Drommete Klang,
Alle Dämme der Streitlust niedertraten,
Und mit Bächen von Blut,
Die granitene Bahn des Siegs sich sprengten:
Siehe, die Jungfraun rief′ ich herbei des Landes,
Daß sie zum Kranz den Lorbeer flöchten,
Dir die Scheitel, o Herr, zu krönen!
Aber wen ruf ich (o Herz, was klopfst du?),
Und wo blüht, an welchem Busen der Mutter
So erlesen, wie sie aus Eden kam,
Und wo duftet, auf welchem Gipfel,
Unverwelklich, wie er Alciden kränzet,
Jungfrau und Lorbeer, dich, o Karl, zu krönen,
Überwinder des Unüberwindlichen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
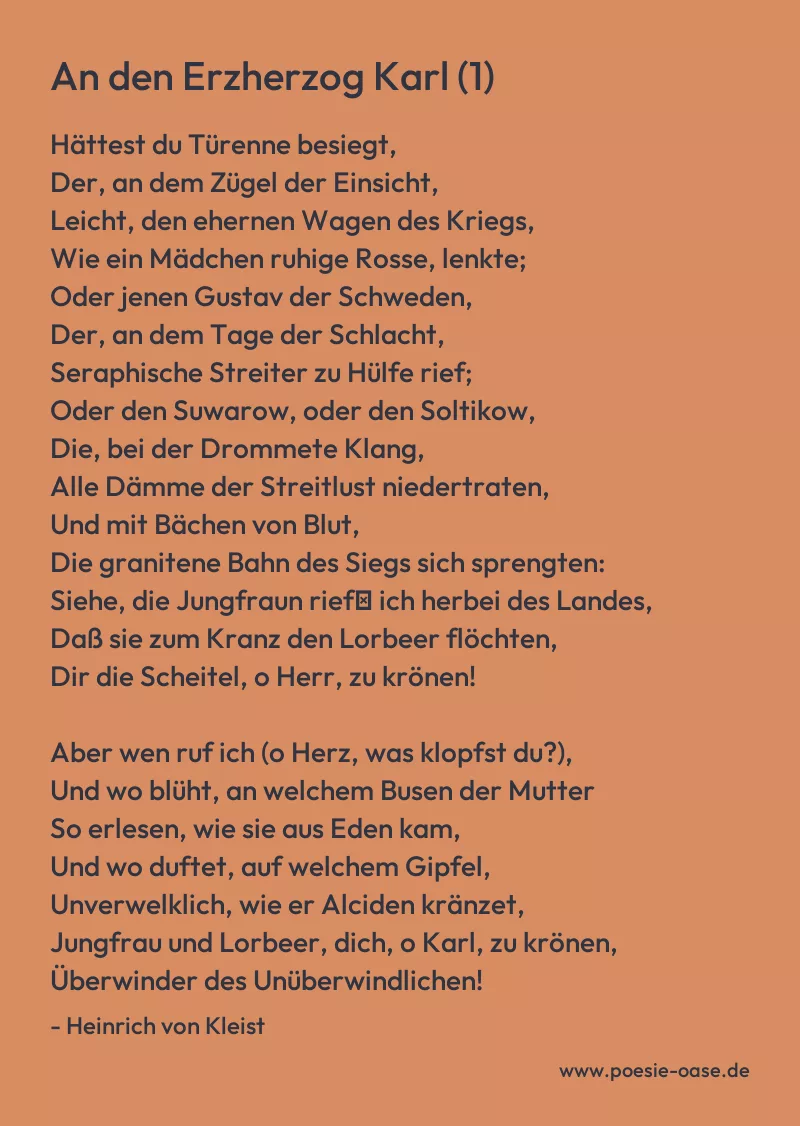
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Erzherzog Karl (1)“ von Heinrich von Kleist ist eine ergreifende Ode, die sich mit dem Thema des Ruhms und der militärischen Tapferkeit auseinandersetzt, aber gleichzeitig die Grenzen menschlichen Heldentums und die Unmöglichkeit einer vollkommenen Verehrung aufzeigt. Der Dichter beginnt mit dem Vergleich des Erzherzogs Karl mit anderen großen Feldherren wie Türenne, Gustav von Schweden, Suwarow und Soltikow, die durch ihre militärischen Erfolge Geschichte geschrieben haben. Kleist stellt fest, dass diese Personen in der Lage gewesen wären, einen Triumphzug auszulösen, bei dem Jungfrauen des Landes Kränze flochten, um sie zu ehren. Dieser eröffnende Teil des Gedichts etabliert ein klares Bild des militärischen Ruhms und der traditionellen Feier des Sieges.
Die zweite Hälfte des Gedichts nimmt jedoch eine Wendung. Kleist wendet sich dem Erzherzog Karl direkt zu und stellt eine rhetorische Frage, die die Möglichkeit eines solchen Triumphzugs in Frage stellt. Die Frage „Aber wen ruf ich (o Herz, was klopfst du?)“ deutet auf eine innere Zerrissenheit und ein Zögern des Dichters hin. Er sucht nach einer Jungfrau, die Karl mit einem Kranz aus Lorbeer krönen könnte. Der Dichter sucht nach einer Schönheit, die so erlesen ist wie jene aus dem Paradies, und nach einem Lorbeer, der so unvergänglich ist wie der, mit dem die Helden der Antike geehrt wurden. Diese Suche wird zur Metapher für die Unmöglichkeit, einen Ruhm zu finden, der der Leistung des Erzherzogs gerecht werden kann, oder eine Anbetung, die vollkommen ist.
Die Verwendung von Hyperbeln und rhetorischen Fragen unterstreicht die tiefe Bewunderung Kleists für den Erzherzog, aber auch die Erkenntnis der Grenzen menschlicher Anerkennung. Die Begriffe „Überwinder des Unüberwindlichen“ und der Vergleich mit den Helden der Antike zeigen die enorme Wertschätzung für Karls Fähigkeiten. Gleichzeitig suggeriert die Unfähigkeit, eine passende Huldigung zu finden, die Begrenztheit menschlicher Sprache und die Unzulänglichkeit, die Größe eines solchen Feldherrn angemessen zu erfassen. Das Gedicht spiegelt somit Kleists tiefes Verständnis von Heldentum wider, das sowohl Bewunderung als auch die Erkenntnis der Grenzen menschlicher Fähigkeiten umfasst.
Die Struktur des Gedichts, die von einem vergleichenden Lobgesang zu einer tiefgründigen Frage übergeht, verstärkt seine emotionale Wirkung. Die anfängliche Aufzählung der großen Feldherren dient als Vorbereitung für die darauffolgende Frage, die eine tiefere Reflexion auslöst. Die Verwendung von Bildern der Natur, wie „Gipfel“ und „Lorbeer“, verleiht dem Gedicht eine poetische Schönheit und Tiefe, während die wiederholten rhetorischen Fragen die innere Zerrissenheit des Dichters und die Unfähigkeit, angemessene Worte für die Größe des Erzherzogs zu finden, hervorheben. Kleist hinterfragt also nicht nur die Möglichkeit, einen Helden zu ehren, sondern auch die Natur der Heroenverehrung selbst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.