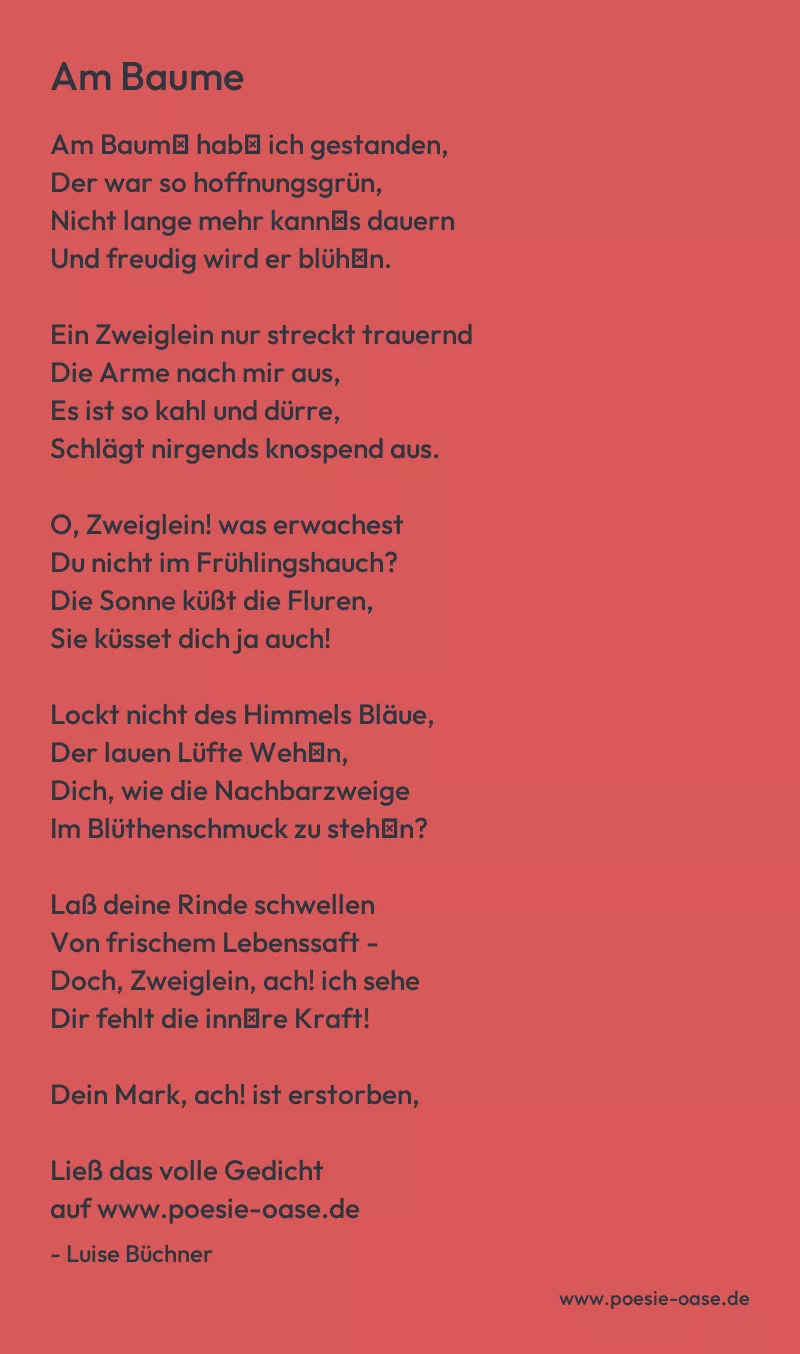Am Baum′ hab′ ich gestanden,
Der war so hoffnungsgrün,
Nicht lange mehr kann′s dauern
Und freudig wird er blüh′n.
Ein Zweiglein nur streckt trauernd
Die Arme nach mir aus,
Es ist so kahl und dürre,
Schlägt nirgends knospend aus.
O, Zweiglein! was erwachest
Du nicht im Frühlingshauch?
Die Sonne küßt die Fluren,
Sie küsset dich ja auch!
Lockt nicht des Himmels Bläue,
Der lauen Lüfte Weh′n,
Dich, wie die Nachbarzweige
Im Blüthenschmuck zu steh′n?
Laß deine Rinde schwellen
Von frischem Lebenssaft –
Doch, Zweiglein, ach! ich sehe
Dir fehlt die inn′re Kraft!
Dein Mark, ach! ist erstorben,
Vom Winterfrost verzehrt,
Dein zartes Leben haben
Die Stürme rauh zerstört.
Für dich scheint keine Sonne,
Weht keine Frühlingsluft,
Dir sind die Lenzgefilde
Nur eine Todtengruft. –
Ich gehe still von dannen,
Und denk′ an dich zurück,
Und an so mancher Herzen
Dahin gewelktes Glück.
In deren zarte Blüthe
Auch drang so eisig Weh′n,
Daß unter den Lebend′gen
Sie wie Gestorb′ne steh′n!