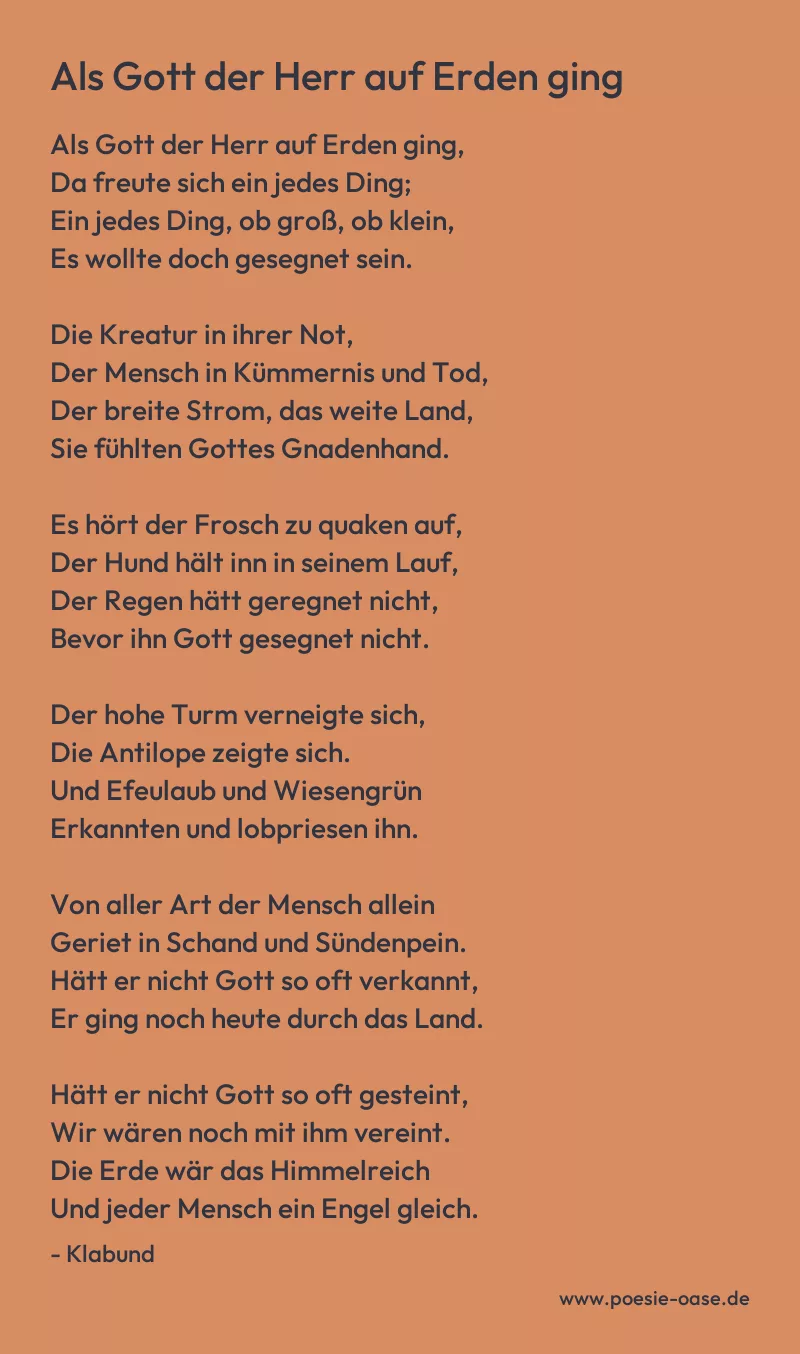Als Gott der Herr auf Erden ging
Als Gott der Herr auf Erden ging,
Da freute sich ein jedes Ding;
Ein jedes Ding, ob groß, ob klein,
Es wollte doch gesegnet sein.
Die Kreatur in ihrer Not,
Der Mensch in Kümmernis und Tod,
Der breite Strom, das weite Land,
Sie fühlten Gottes Gnadenhand.
Es hört der Frosch zu quaken auf,
Der Hund hält inn in seinem Lauf,
Der Regen hätt geregnet nicht,
Bevor ihn Gott gesegnet nicht.
Der hohe Turm verneigte sich,
Die Antilope zeigte sich.
Und Efeulaub und Wiesengrün
Erkannten und lobpriesen ihn.
Von aller Art der Mensch allein
Geriet in Schand und Sündenpein.
Hätt er nicht Gott so oft verkannt,
Er ging noch heute durch das Land.
Hätt er nicht Gott so oft gesteint,
Wir wären noch mit ihm vereint.
Die Erde wär das Himmelreich
Und jeder Mensch ein Engel gleich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
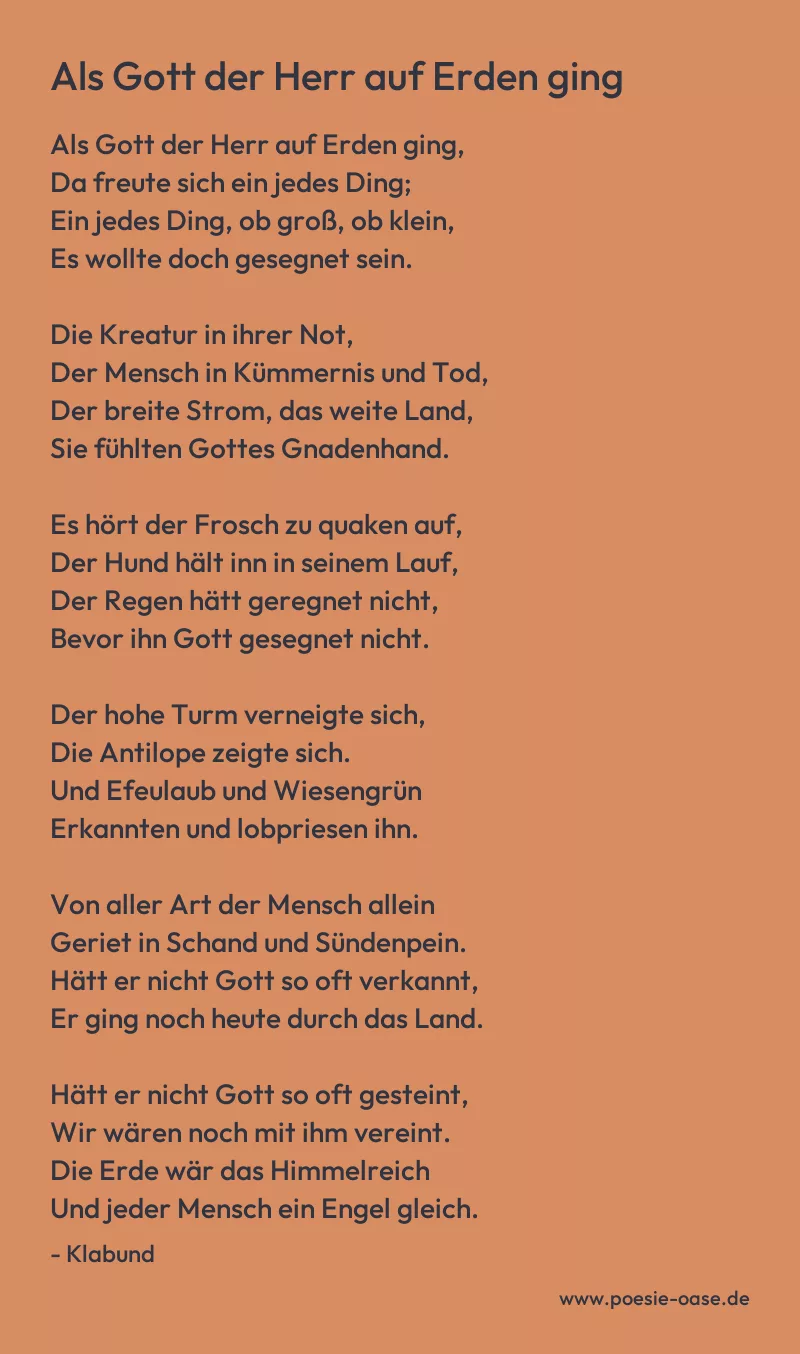
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Als Gott der Herr auf Erden ging“ von Klabund zeichnet ein idyllisches Bild einer Welt, die sich über die Gegenwart Gottes freut und von ihm gesegnet wird. Das Gedicht beginnt mit der universellen Freude über Gottes Ankunft, wobei „ein jedes Ding“ und die gesamte Schöpfung, ob groß oder klein, von diesem Segen profitieren möchte. Die ersten vier Strophen beschreiben eine harmonische Welt, in der die Kreaturen und Elemente der Natur in Andacht innehalten und die Gegenwart Gottes ehren. Der Frosch verstummt, der Hund pausiert, und der Regen hält sich zurück, bis er gesegnet ist. Diese Bilder unterstreichen die Einheit und den Frieden, der durch die göttliche Anwesenheit geschaffen wird.
Die fünfte und sechste Strophe wenden sich jedoch dem Menschen zu und enthüllen einen tragischen Gegensatz. Während die gesamte Schöpfung Gottes Anwesenheit begrüßt, versinkt der Mensch in „Schand und Sündenpein“. Klabund kritisiert die wiederholte Missachtung und Ablehnung Gottes durch den Menschen, die letztendlich zur Trennung von der göttlichen Gnade geführt hat. Die Wiederholung von „Hätt er nicht Gott so oft verkannt“ und „Hätt er nicht Gott so oft gesteint“ betont die Verantwortung des Menschen für seine eigene Misere. Dies impliziert, dass der Mensch, durch seine Taten, sich selbst aus dem Paradies verbannt hat.
Das Gedicht kulminiert in einer Sehnsucht nach einer besseren Welt. Die letzten Zeilen malen ein Bild, wie die Welt wäre, wenn der Mensch nicht Gott verkannt hätte. Hier wird das Ideal einer Einheit von Himmel und Erde skizziert, in der jeder Mensch einem Engel gleicht. Diese Vision dient als Gegenentwurf zur gegenwärtigen Realität und verdeutlicht die Tragweite des menschlichen Versagens. Das Gedicht ist also eine Mahnung und eine Anklage an die Menschheit, die durch ihre Ablehnung Gottes, die Harmonie und den Frieden der Schöpfung zerstört hat.
Klabund verwendet eine einfache, zugängliche Sprache und einen klaren Reim, um seine Botschaft zu vermitteln. Der fließende Rhythmus und die bildreichen Beschreibungen machen das Gedicht leicht verständlich und eindrucksvoll. Die Gegensätze zwischen der Freude der Natur und der Verdammnis des Menschen verstärken die kritische Botschaft. Die Verwendung von einfachen Verben und direkten Aussagen unterstreicht die Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit der Kritik, die Klabund an der Menschheit übt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.