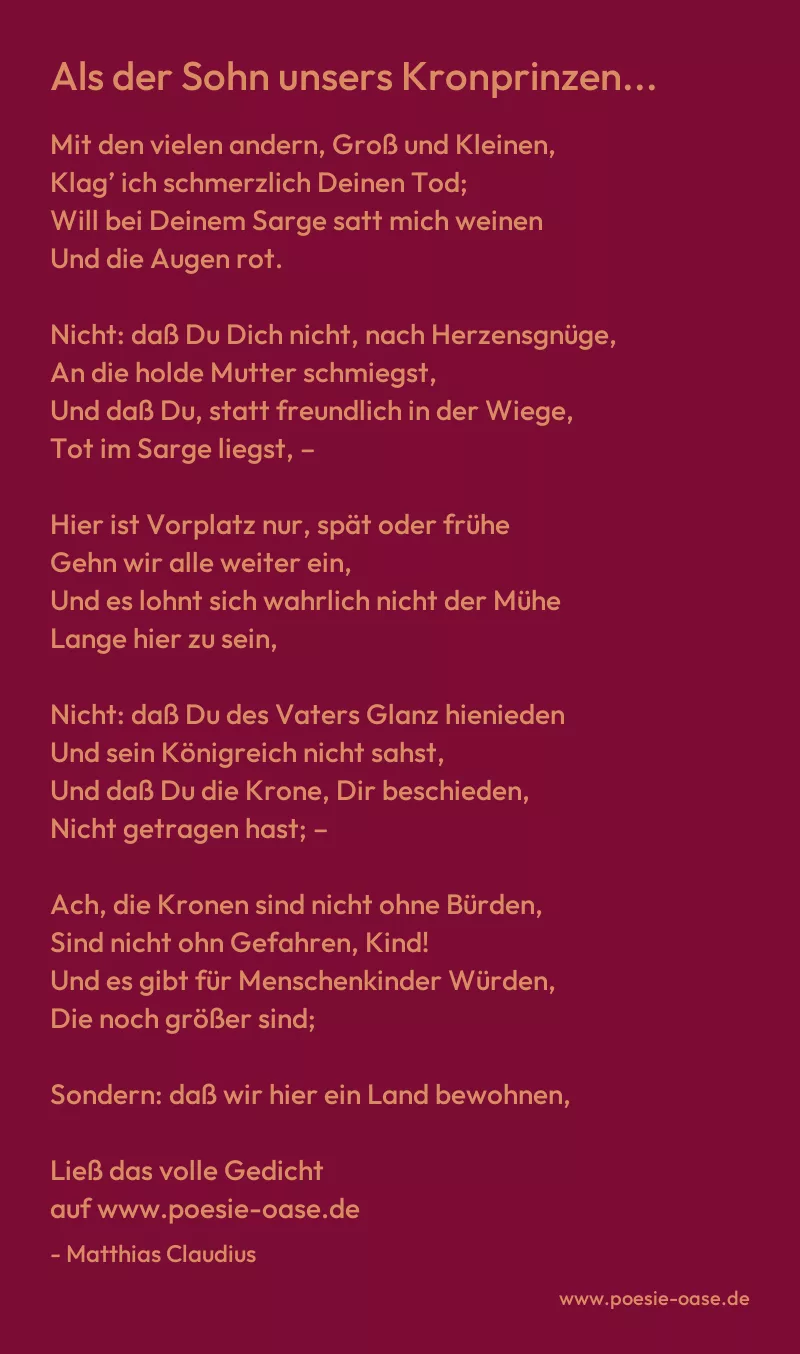Mit den vielen andern, Groß und Kleinen,
Klag’ ich schmerzlich Deinen Tod;
Will bei Deinem Sarge satt mich weinen
Und die Augen rot.
Nicht: daß Du Dich nicht, nach Herzensgnüge,
An die holde Mutter schmiegst,
Und daß Du, statt freundlich in der Wiege,
Tot im Sarge liegst, –
Hier ist Vorplatz nur, spät oder frühe
Gehn wir alle weiter ein,
Und es lohnt sich wahrlich nicht der Mühe
Lange hier zu sein,
Nicht: daß Du des Vaters Glanz hienieden
Und sein Königreich nicht sahst,
Und daß Du die Krone, Dir beschieden,
Nicht getragen hast; –
Ach, die Kronen sind nicht ohne Bürden,
Sind nicht ohn Gefahren, Kind!
Und es gibt für Menschenkinder Würden,
Die noch größer sind;
Sondern: daß wir hier ein Land bewohnen,
Wo der Rost das Eisen frißt,
Wo durchhin, um Hütten wie um Thronen,
Alles brechlich ist;
Wo wir hin aufs Ungewisse wandeln,
Und in Nacht und Nebel gehn,
Nur nach Wahn und Schein und Täuschung handeln,
Und das Licht nicht sehn;
Wo im Dunkeln wir uns freun und weinen,
Und rund um uns, rund umher,
Alles, alles, mag es noch so scheinen,
Eitel ist und leer.
O du Land des Wesens und der Wahrheit,
Unvergänglich für und für!
Mich verlangt nach dir und deiner Klarheit;
Mich verlangt nach dir.