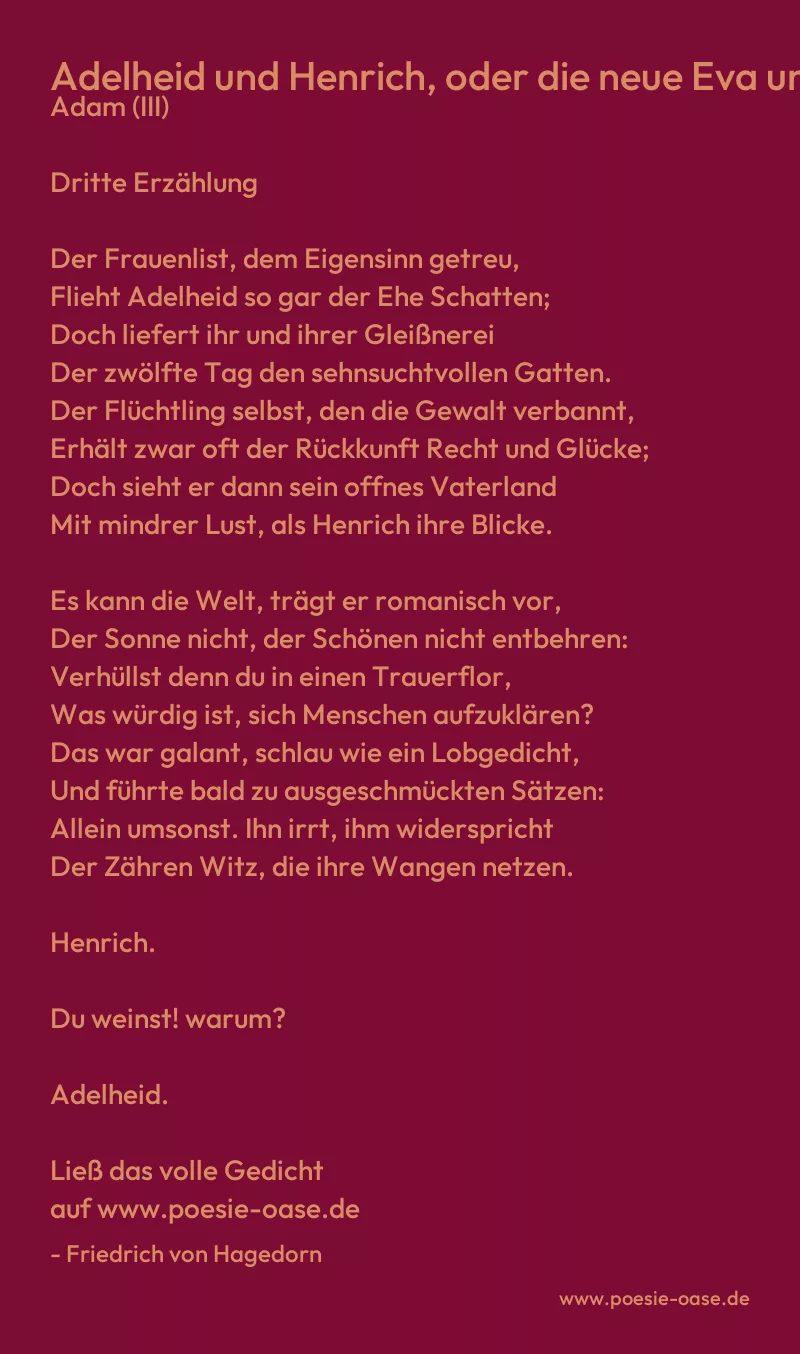Dritte Erzählung
Der Frauenlist, dem Eigensinn getreu,
Flieht Adelheid so gar der Ehe Schatten;
Doch liefert ihr und ihrer Gleißnerei
Der zwölfte Tag den sehnsuchtvollen Gatten.
Der Flüchtling selbst, den die Gewalt verbannt,
Erhält zwar oft der Rückkunft Recht und Glücke;
Doch sieht er dann sein offnes Vaterland
Mit mindrer Lust, als Henrich ihre Blicke.
Es kann die Welt, trägt er romanisch vor,
Der Sonne nicht, der Schönen nicht entbehren:
Verhüllst denn du in einen Trauerflor,
Was würdig ist, sich Menschen aufzuklären?
Das war galant, schlau wie ein Lobgedicht,
Und führte bald zu ausgeschmückten Sätzen:
Allein umsonst. Ihn irrt, ihm widerspricht
Der Zähren Witz, die ihre Wangen netzen.
Henrich.
Du weinst! warum?
Adelheid.
Jüngst sagtest du, mir träumt.
Ach! du hast Recht, auch wann du mich betrübest.
Was ich verlang′, ist freilich ungereimt;
Doch desto mehr bezeugt es, daß du liebest.
Der Even Reiz zwang ihren armen Mann,
So Paradies als Leben zu verschmähen
Ich spreche dich nur um zwölf Faden an;
Zwölf Faden nur weiß ich nicht zu erflehen.
Gleichgiltiger! dein Herz entlarvt sich mir,
So sehr es auch die Reden noch verhehlen:
An Dankbarkeit, an Liebe muß es dir,
Wo nicht, mir selbst, für dich, an Schönheit fehlen.
Sie knirscht bethränt, kehrt sich von ihm zurück,
Und zeigt den Ernst gebietrischer Gedanken.
Kein Wort versöhnt ihr Aug′ und ihren Blick:
Ihr Auge droht, und ihre Blicke zanken.
Er schweigt, und sinnt, neigt, und entfernet sich,
Und denkt, die Frau mißbrauchet ihre Gaben;
Ihr Grillenfang ist mehr als lächerlich;
Die Rednerin will mich zum Besten haben.
Das geht zu weit: die Absicht merk′ ich schon.
Doch ich bin Herr; mich muß man so nicht trillen.
Man lasse nicht, das lehrt uns Sirachs Sohn,
Dem Wasser Raum, dem Weibe seinen Willen.
Indem ihn nun der Eifer übernahm,
Hört er nicht auf, sein Schicksal zu verfluchen,
Als ungefähr die Schwiegermutter kam,
Frau Hildegard, die Tochter zu besuchen.
Ihr macht er bald der Tochter Streich bekannt.
Sie soll, spricht er, noch heute mit uns speisen:
Und kitzelt sie der edle Wittwenstand,
So kann ihr Kind schon morgen von mir reisen.
Die Alte stutzt, sinkt fast in Ohnmacht hin,
Und sagt zuletzt: Man wird sie schon bewegen;
In diesem Zwist dien′ ich zur Mittlerin,
Und gebe dann dem Frieden meinen Segen.
O schlimme Zeit! Wer hätte das gedacht
Von solchem Paar, und solchen gleichen Sitten!
Sie spricht ihr zu; doch mütterlicher Macht
Ward nie so schön von Töchtern widerstritten.
Die wirft die Schuld auf ihren Mann allein;
Sie werd′ ein Spott für beiderlei Geschlechte,
Er weigre sich, schwach, und ihr gleich zu sein:
(So schimpft ein Weib der Mann, der Ungerechte!)
Was hab′ er wol, da sie ihn so verehrt,
Mit seinem Sumpf, mit seiner Wette wollen,
Als daß sie sich, durch Sicherheit bethört,
Vor aller Welt recht sehr vergehen sollen?
Ist, fährt sie fort, mein Henrich nun ein Held
In aller List, die Even zu berücken,
So lass′ er sie dem Hohn nicht ausgestellt,
So lern′ er sich in Adams Rolle schicken.
Er halte nur sein stolzes Siegesmahl:
Ich faste heut′; er wird es mir vergeben.
Doch weil er mir zu reisen anbefahl,
So reis′ ich gern, und eil′ in′s Klosterleben.
Was denken sie? Dem Falschen schreib′ ich noch.
Verdienet er dieß letzte Freundschaftszeichen?
Ich hin zu weich … Sie selber werden doch
Ohn′ Aufschub ihm dieß Schreiben überreichen:
»Gestrenger Herr, die Scheidung geh′ ich ein;
Doch Schönern nur gönn′ ich, was ich besessen.
Sie leben wohl! Das Kloster wartet mein;
Ich kann die Welt, ach könnt′ ich Sie vergessen!«
Sie bringt den Brief, und klagt, wie ihr Bemühn
Genug versucht, allein vergeblich worden.
Es war bei ihm der Bruder Cölestin,
Ein guter Mönch vom Franciscanerorden,
Ein Beichtiger, der, wider andrer Art,
Das Kloster halb, die Weiber ganz regieret,
Dem Hildegard vertraulich offenbart,
Was Adelheid zur Buß′ und Zelle führet.
O, ruft er aus, wie glücklich ist ihr Kind!
Gewiß, sie weiht sich meiner Seelenpflege.
Ich wette drauf … Wie unerforschlich sind,
Wie wunderbar der weisen Schickung Wege!
Der Sünde Bild, ein unflathvoller Sumpf,
Veranlaßt sie zu ihrer frommen Rache.
Dem Heiligen dient dieses zum Triumph:
Den Pfuhl nenn′ ich die Sanct-Franciscus-Lache.
Der Lehrer spricht, die Alte horcht, und keicht,
Der Mann entwischt, vertieft in Sorg′ und Fehde,
Und, als er kaum sein Cabinet erreicht,
So hält er dort sich diese schöne Rede:
Die meinen Kuß verschwenderisch vergilt,
Wie will mich die, wie kann ich sie, verlieren?
Das schöne Weib! Hier hab′ ich noch ihr Bild,
Das gab sie mir, abwesend mich zu rühren.
Dieß Bild ist ihr in jedem Vorzug gleich,
An Freundlichkeit, an Jugend, an Vergnügen.
So lächelt sie: so schlau, so feuerreich
Sind Aug′ und Blick, und so gewiß zu siegen.
Wie ist ihr Witz so ähnlich der Gestalt,
Schön ohne Kunst, die Freude muntrer Herzen!
Hab′ ich allein die traurige Gewalt,
Den schweren Stolz, das alles zu verscherzen?
Uns Männer schimpft, was Adelheide bat.
Hilft falscher Ruhm? entehret falsche Schande?
Wird Männern hier das Spinnen zum Verrath,
Und schadet es dem deutschen Vaterlande?
Die Einfalt macht, daß ländlich sittlich heißt.
Ein weiser Mann ist Schöpfer seiner Sitten;
Und immer hat ein unerschrockner Geist
Dem Wahn getrotzt, das Vorurtheil bestritten.
Aegypten war die Zuflucht der Vernunft,
Wo Griechen selbst, als Weisheitschüler, lebten,
Und weiß man nicht, daß dort der Weiber Zunft
Geschäfte trieb, und ihre Männer webten?
Zu meinem Glück ist mir mein Evgen gut:
Sie hat mir ja nichts Schweres aufgeladen.
Es hätte mir ein Weib von stolzerm Muth
Leicht auferlegt, im Schlamme mich zu baden.
Am Manzanar müßt ich jetzt ritterlich,
Zu ihrem Ruhm, mit Rittern mich zerfetzen,
Und ließe selbst, so wie ein Roderich,
Den stärksten Stier auf meine Lanze hetzen.
Ich spinne nur, und selbst Alcides spann.
Für diesesmal will ich die Sache glauben.
Der war doch auch ein braver Edelmann,
Und ließ sich nie von alten Junkern schrauben.
Es sei gewagt! Es mag der Leute Wahn
Mir immerhin die Klugheit aberkennen,
Und, wann er will, mich den geneckten Hahn,
Den guten Mann, den neuen Adam nennen!
Damit ihr Scherz sich nicht unleidlich macht,
Lach ich zuerst, ihm selbst zuvorzukommen,
Weil man nicht lang um ein Verfahren lacht,
Wenn der nur lacht, der solches vorgenommen.
Geliebte Frau, die Trennung unterbleibt.
Mir wehrt mein Herz, dir Seufzer abzupressen.
Wie schmeichelt mir, was deine Treue schreibt:
»Ich kann die Welt, ach könnt′ ich Sie vergessen!«
Er eilt zurück, und schwört der Hildegard,
Es soll ihm nun die Wittwe nicht entfliehen:
Er sei bereit, in ihrer Gegenwart,
Der Adelheid Befehle zu vollziehen.
Sie säumen nicht, und gehn in ihr Gebiet.
Sie schlägt, entstellt, die schönen Augen nieder.
Sobald sie ihn vor ihrem Rocken sieht,
Erholt sie sich, blickt auf, und lächelt wieder.
Die Liebe lenkt, unsichtbar, seine Hand,
Sie zählt mit ihm die Faden, die sie spinnen;
Und, als sich nun der zwölfte Faden wand,
Kömmt Adelheid, und ihre Thränen rinnen.
Sie bricht ihn ab. Noch weinet sie vor Lust,
Als Henrich ihr den schlanken Leib umschlinget,
Und wiederum der lang′ entbehrten Brust
Mit Ungeduld der Ehe Weihkuß bringet.
Beglücktes Paar! So vieler Freuden Zahl
Merkt kaum der Neid, und hofft kaum das Verlangen.
So haben sich, nach überstandner Qual,
Die Pamela und ihr Gemahl umfangen.
Sie spricht: Mein Herr, was du für mich gewagt,
Beschämt dich nie: ich schwör′ es bei der Liebe.
Es zeigt dein Herz, das sich dem Wahn versagt,
Voll Großmuth ist, und würdig edler Triebe.
Die meisten drückt der Klügler Vormundschaft,
Bis an den Tod, mit meisternden Geschwätzen:
Mein freier Mann wird Männern tadelhaft,
Der Weiber Ruf in Sicherheit zu setzen.
Nur dies Gespinst soll mir ein Reichthum sein.
Dies Pfand der Gunst will ich mit Gold umwinden.
Du wirst es stets, an einem Edelstein,
Auf meiner Brust, in Liebesknoten finden.
Die Rede floß mit froher Hurtigkeit.
Der finstre Boy wird eilends abgenommen.
Sie fordert gleich den Schmuck, das Hochzeitkleid,
Vor ihren Mann, als eine Braut, zu kommen.
Ihm, dessen Herz von gleicher Sehnsucht brennt,
Vergeht die Furcht, daß man sie höhnisch richte;
Doch schreibet er an Schälke, die er kennt,
Von beider Fall, recht sinnreich, die Geschichte;
Doch nicht so schön, als Bodmer sie erzählt,
Der malerisch, stark oder scherzhaft, denket,
Und, wenn ihn hier das Nachbild oft verfehlt,
Vielleicht aus Gunst mir Schuld und Buße schenket.
Noch täglich siegt der Schönen Eigensinn.
Der Liebe war die Blindheit immer eigen,
Daher man ihr, zur steten Führerin,
Die Thorheit gab. Auch Henrich kann′s bezeugen.
Er schrieb zugleich: Hätt′ einer Recht und Witz,
Das erste Paar in ihnen zu belachen,
So lad′ er ihn auf seinen Rittersitz,
Gemeinschaftlich sich diese Lust zu machen.
Ein jeder Mann, der dies erfuhr, befand,
Man müss′ jetzt ihn für Adams Sohn erkennen.
Ein jedes Weib, und Grimmhild selbst, gestand,
Man müsse sie der Even Tochter nennen.