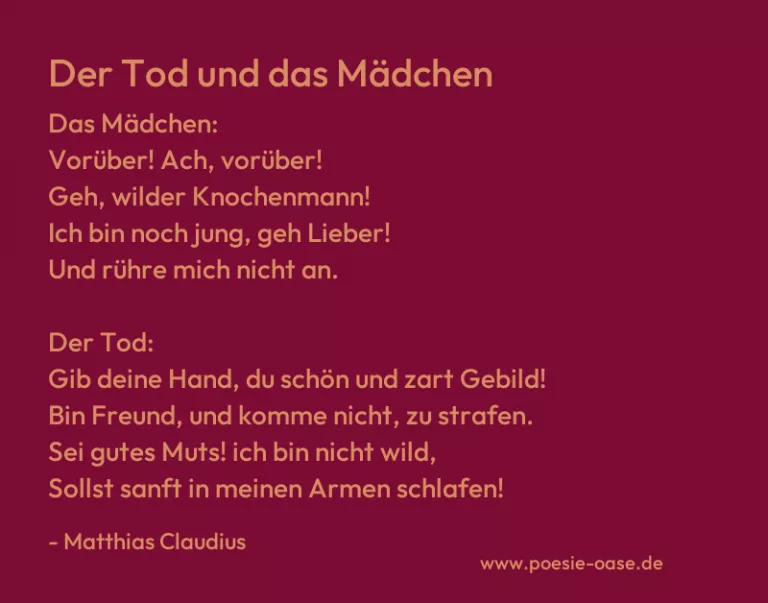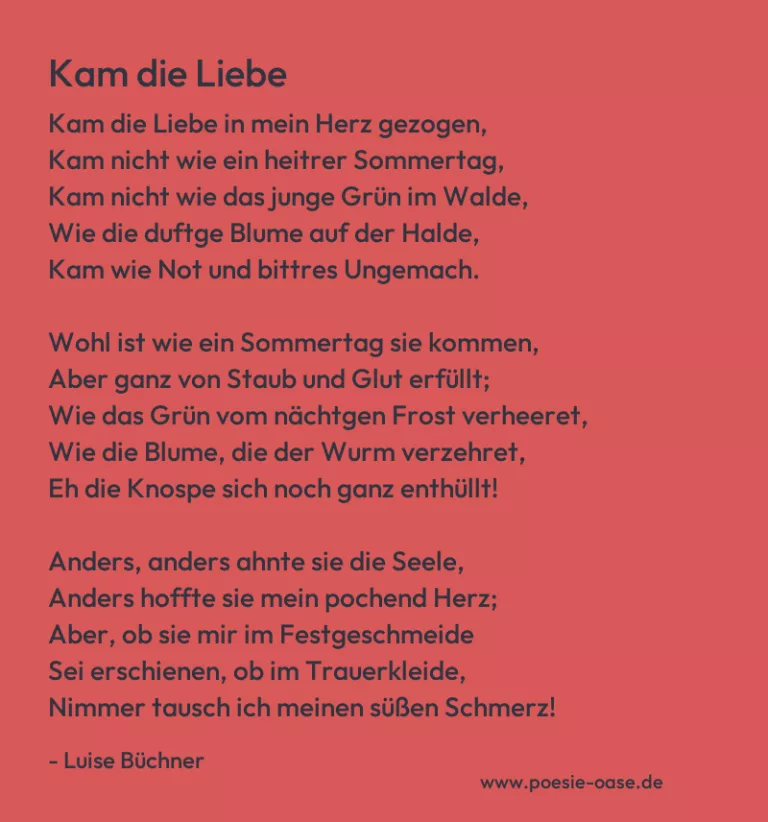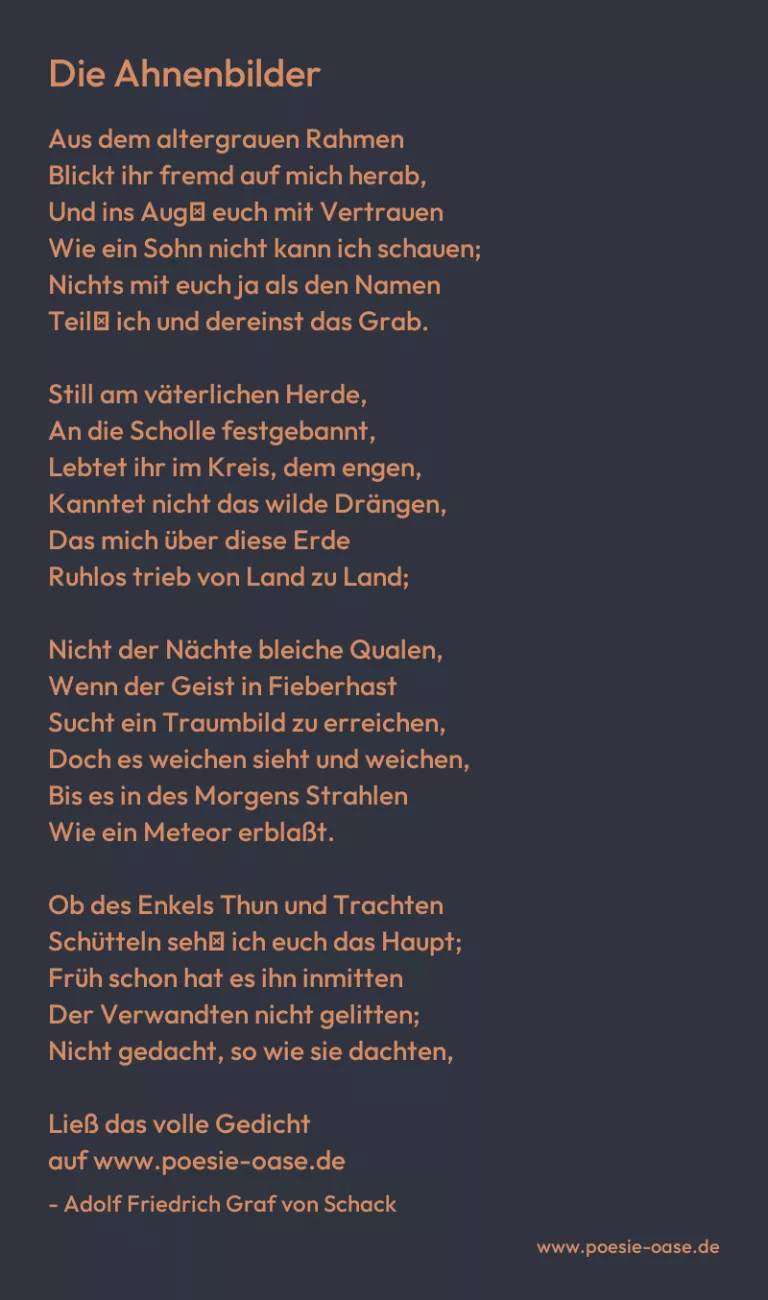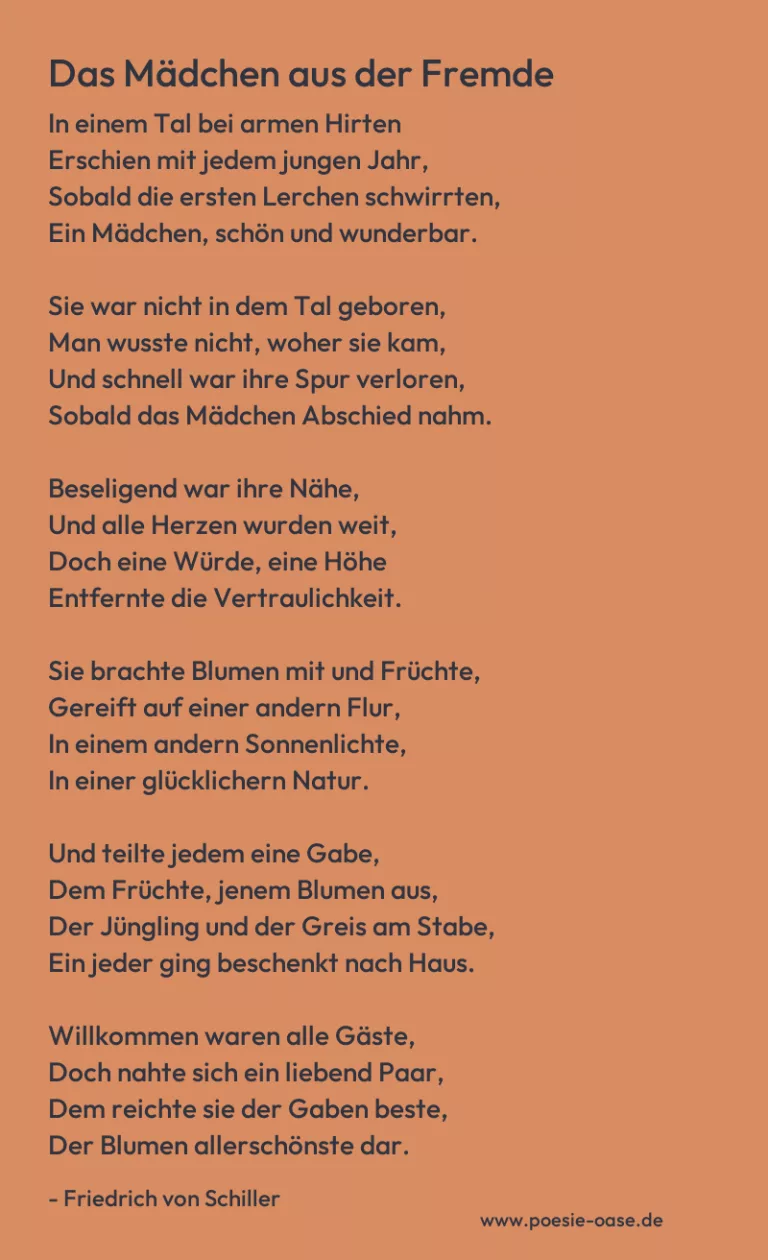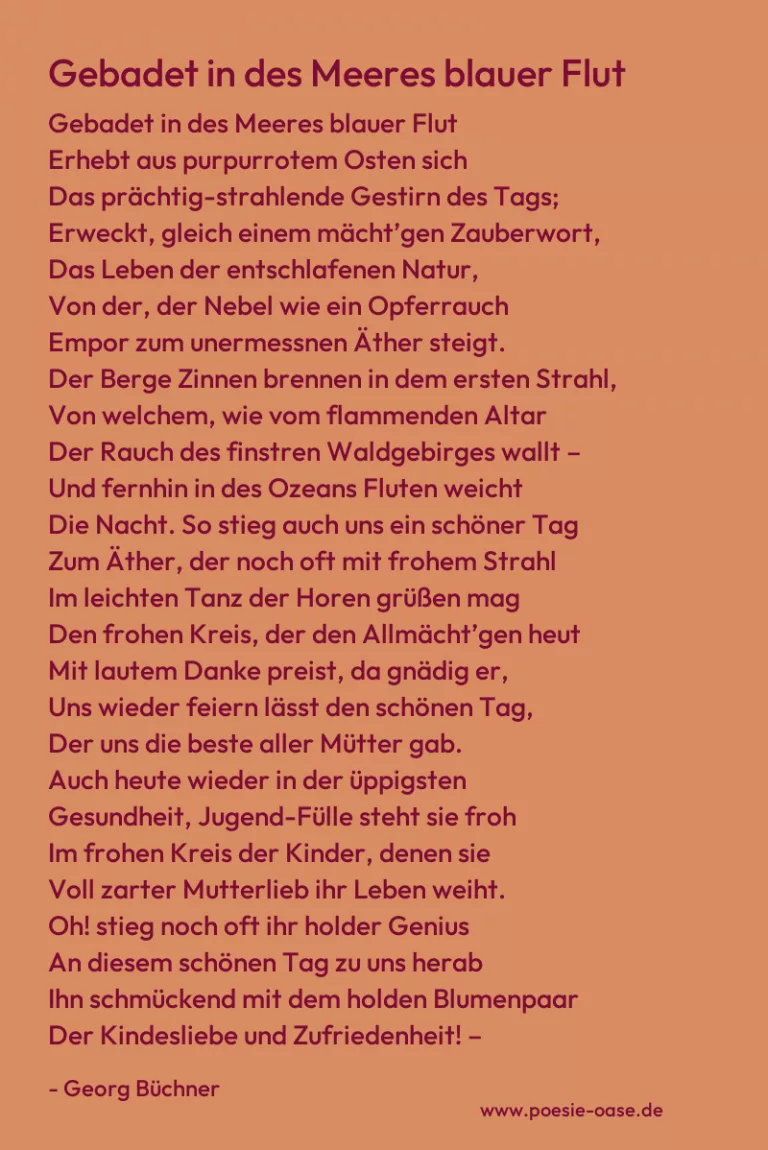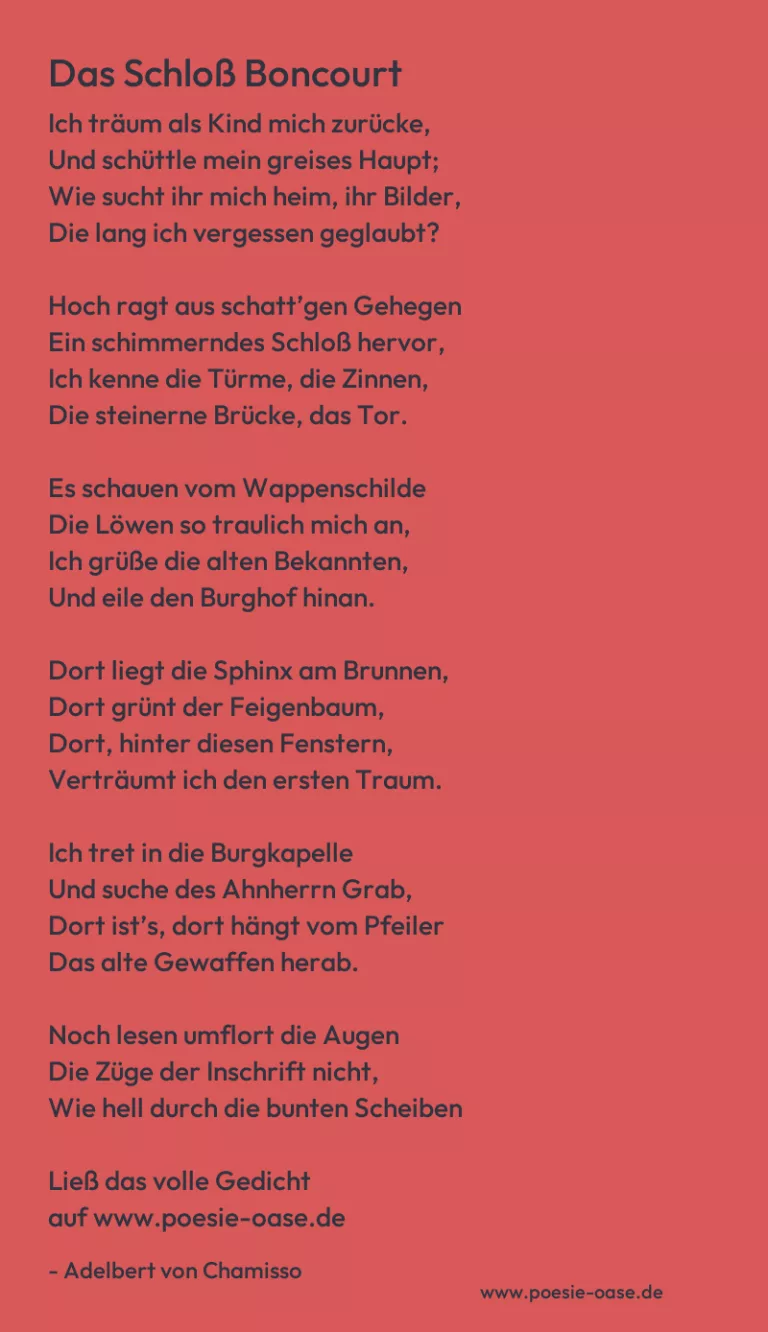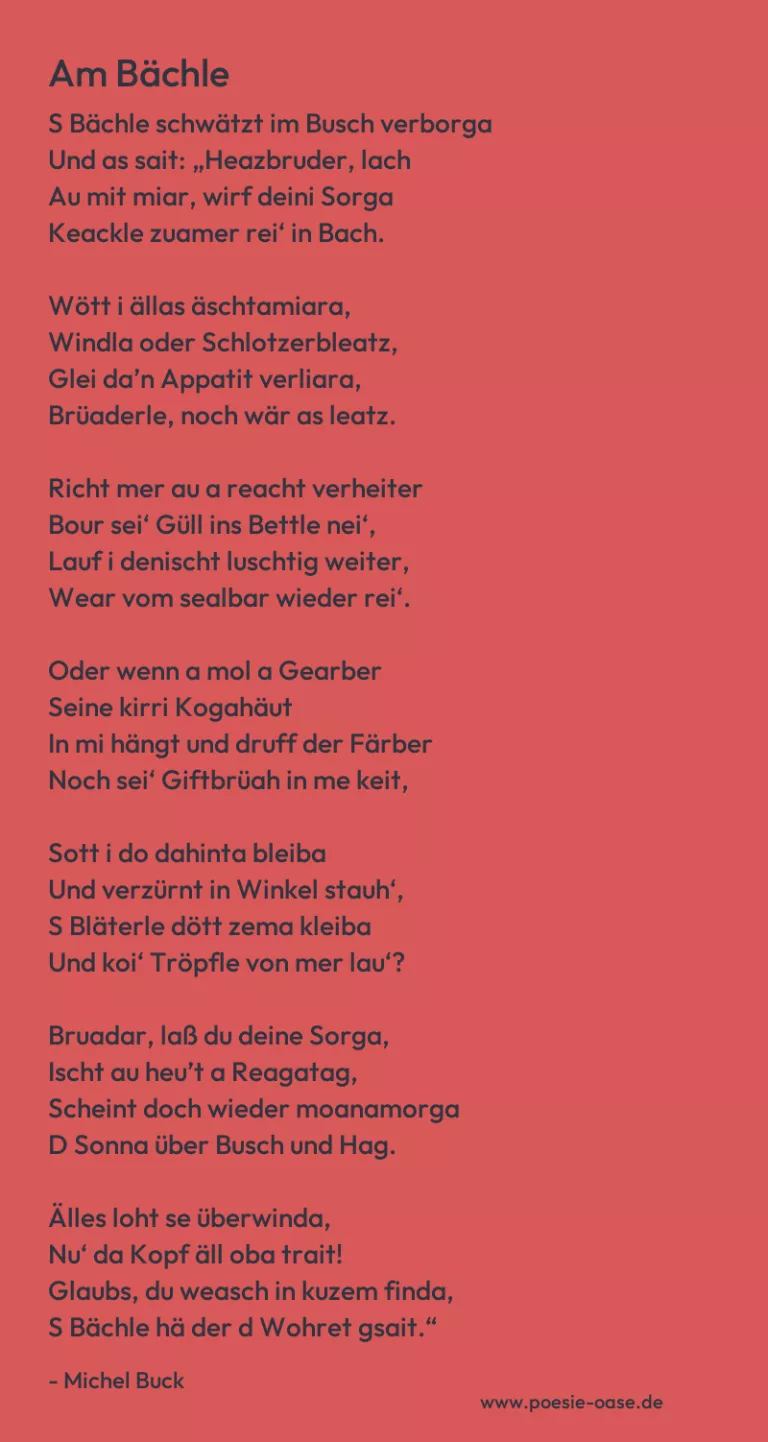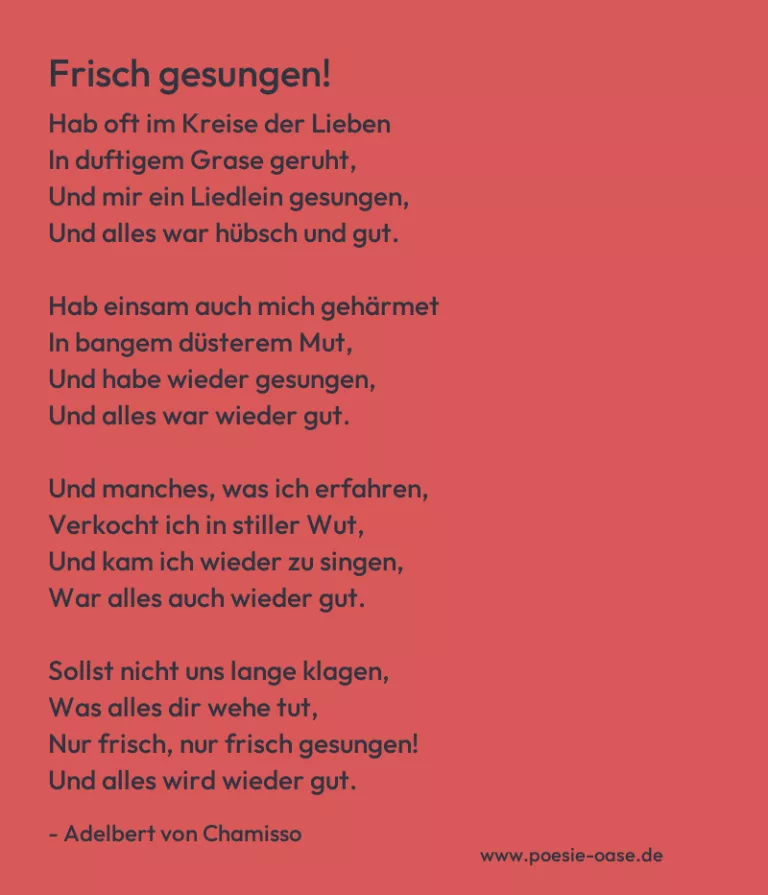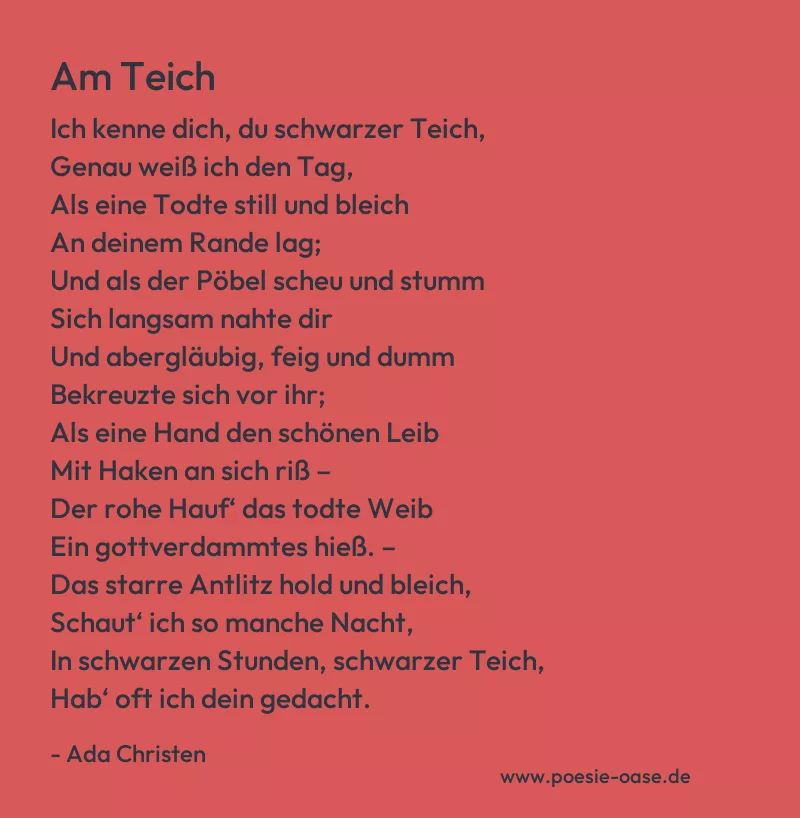Am Teich
Ich kenne dich, du schwarzer Teich,
Genau weiß ich den Tag,
Als eine Todte still und bleich
An deinem Rande lag;
Und als der Pöbel scheu und stumm
Sich langsam nahte dir
Und abergläubig, feig und dumm
Bekreuzte sich vor ihr;
Als eine Hand den schönen Leib
Mit Haken an sich riß –
Der rohe Hauf‘ das todte Weib
Ein gottverdammtes hieß. –
Das starre Antlitz hold und bleich,
Schaut‘ ich so manche Nacht,
In schwarzen Stunden, schwarzer Teich,
Hab‘ oft ich dein gedacht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
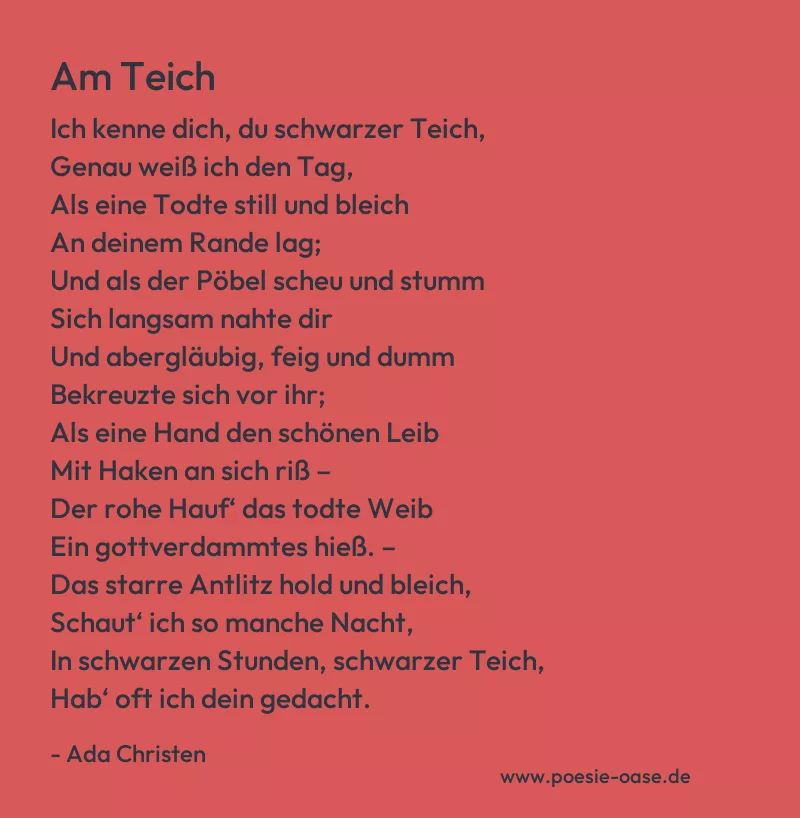
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Am Teich“ von Ada Christen thematisiert in düsterer Bildsprache Tod, Ausgrenzung und gesellschaftliche Verurteilung. Der schwarze Teich wird zum Schauplatz eines tragischen Geschehens, das sich unauslöschlich in das Gedächtnis des lyrischen Ichs eingebrannt hat. Die Erinnerung an den leblosen Körper einer Frau – ausgestoßen, verachtet, vielleicht Opfer eines Freitods – steht im Zentrum der Reflexion.
Bereits in der ersten Strophe wird die Verbindung zwischen Ort und Ereignis hergestellt. Der Teich ist kein neutraler Naturraum, sondern aufgeladen mit Bedeutung: Er ist Zeuge eines Todes und damit selbst Teil des Schreckens. Die „Todte still und bleich“ liegt am Ufer – die Ruhe ihres Körpers kontrastiert mit der aufgewühlten, abwehrenden Reaktion der Umstehenden.
In der zweiten Strophe wird diese Reaktion des „Pöbels“ deutlich: furchtsam, abergläubisch, dumm – so beschreibt das lyrische Ich die Menschenmenge, die das tote Weib nicht mit Mitgefühl, sondern mit Ablehnung betrachtet. Die Beschreibung der Bergung durch eine „Hand“ mit einem „Haken“ verstärkt die Rohheit der Szene. Die Tote wird entmenschlicht, verurteilt und mit einem Fluch belegt – „ein gottverdammtes“ –, was die gesellschaftliche Grausamkeit betont.
In der letzten Strophe wechselt die Perspektive ins Persönliche. Das lyrische Ich bekennt, dass das Antlitz der Toten es oft heimsucht – in „schwarzen Stunden“. Die Farbe Schwarz, die bereits im Bild des Teiches mitschwingt, wird zur Chiffre für seelische Dunkelheit und Trauer. Der Teich ist damit nicht nur Ort des Geschehens, sondern Symbol eines fortdauernden inneren Zustands: Er steht für Erinnerung, Schuld, vielleicht auch stille Solidarität mit der Verstoßenen.
„Am Teich“ ist ein eindringliches Gedicht über soziale Kälte und das Nachwirken des Todes. Ada Christen stellt nicht die Tote, sondern die Reaktion der Gesellschaft in den Mittelpunkt der Anklage. In der nüchternen, fast dokumentarischen Darstellung liegt eine stille Wut – gegen die Verurteilung des Weiblichen, gegen das Vergessen und gegen die moralische Heuchelei einer Gesellschaft, die sich vor dem Tod bekreuzigt, aber kein Mitgefühl zeigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.