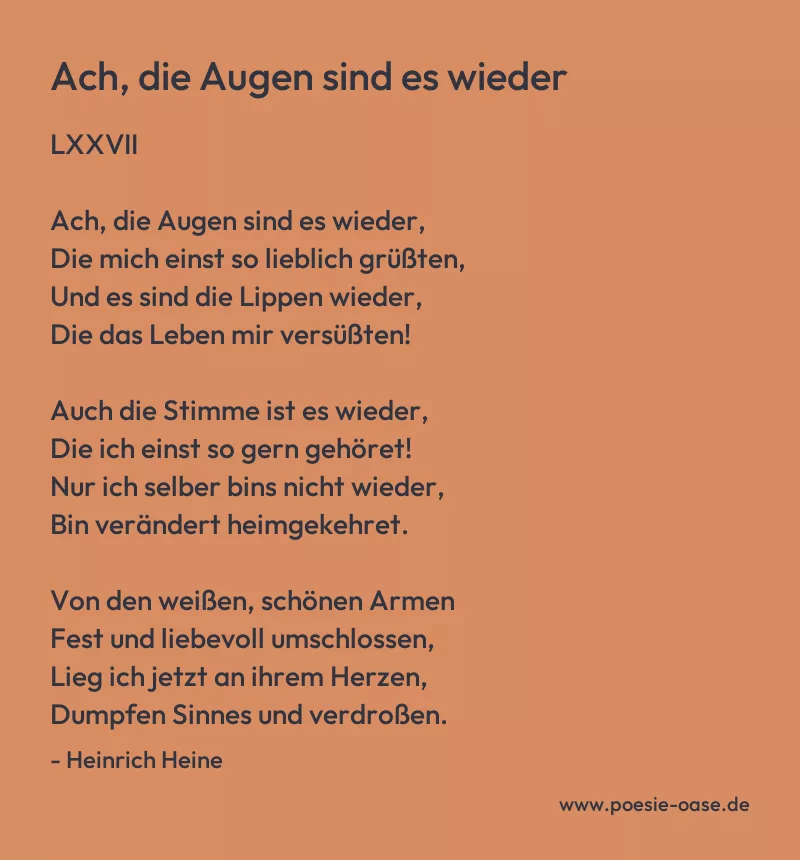Ach, die Augen sind es wieder
LXXVII
Ach, die Augen sind es wieder,
Die mich einst so lieblich grüßten,
Und es sind die Lippen wieder,
Die das Leben mir versüßten!
Auch die Stimme ist es wieder,
Die ich einst so gern gehöret!
Nur ich selber bins nicht wieder,
Bin verändert heimgekehret.
Von den weißen, schönen Armen
Fest und liebevoll umschlossen,
Lieg ich jetzt an ihrem Herzen,
Dumpfen Sinnes und verdroßen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
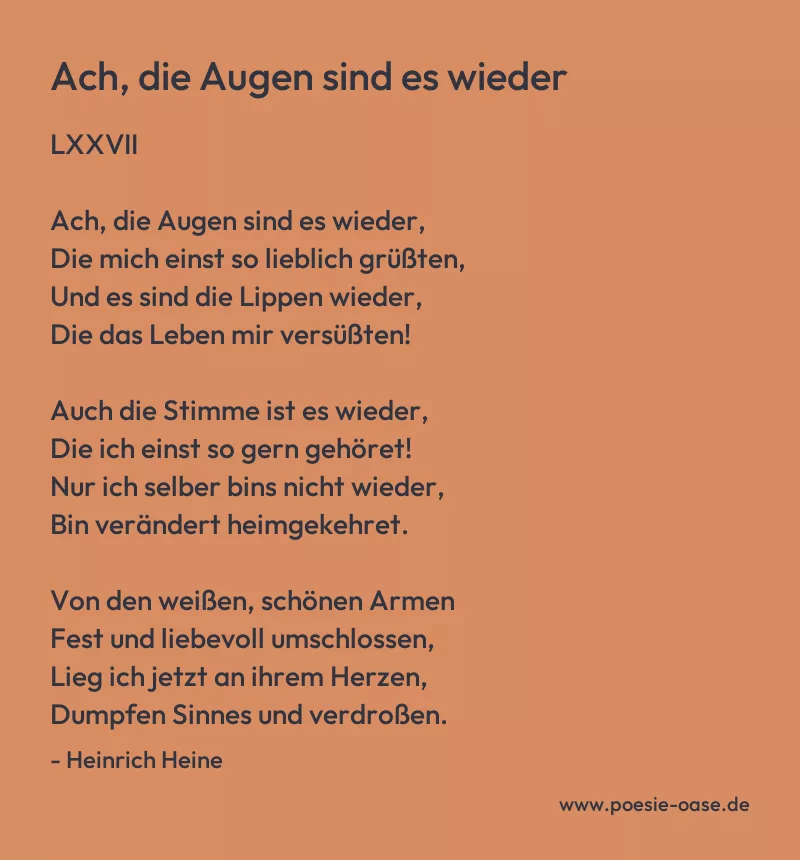
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ach, die Augen sind es wieder“ von Heinrich Heine thematisiert die Erfahrung der Entfremdung und des Verlustes von einstiger Freude und Lebendigkeit. Es handelt von der Wiederbegegnung mit einer geliebten Person und den damit verbundenen Gefühlen des Kontrasts zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die ersten beiden Strophen beschreiben die Wiedererkennung der vertrauten Merkmale der geliebten Frau: ihre Augen, Lippen und Stimme. Diese Elemente wecken Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit, an Liebe und das Gefühl von Leben. Der Dichter scheint sich nach diesen verlorenen Zeiten zu sehnen, doch die zentrale Aussage des Gedichts liegt in dem Unterschied zwischen dem, was einst war, und dem, was jetzt ist.
Die dritte Strophe enthüllt das Dilemma des lyrischen Ichs: Trotz der vertrauten Umgebung und der Zuneigung, die es von der geliebten Person erfährt, ist etwas verloren gegangen. Das lyrische Ich beschreibt sich als verändert und kehrt nach Hause zurück, ein Hinweis auf eine innere Verwandlung, die es durchgemacht hat. Die Zeilen „Nur ich selber bins nicht wieder, / Bin verändert heimgekehret“ sind von zentraler Bedeutung, da sie die innere Distanz und die Unfähigkeit, die frühere Freude zu empfinden, verdeutlichen. Der Dichter fühlt sich entfremdet von sich selbst und seinen früheren Emotionen.
In der letzten Strophe wird die körperliche Nähe zur geliebten Person beschrieben. Das lyrische Ich liegt in den Armen der Frau, fühlt sich von ihr geliebt und gehalten, jedoch empfindet es keine Freude, sondern „dumpfen Sinnes und verdroßen“. Dieser Zustand der Dumpfheit und Verbitterung steht im krassen Gegensatz zu der einstigen Freude und dem Gefühl, das Leben sei versüßt worden. Es wird deutlich, dass der Verlust von etwas tiefer geht als bloße äußere Umstände; es ist der Verlust eines Teils der eigenen Seele, die durch die Erfahrungen des Lebens geprägt und verändert wurde.
Heines Gedicht ist von einer Melancholie geprägt, die sich durch die gesamte Struktur zieht. Die Einfachheit der Sprache, die Verwendung von Wiederholungen wie „wieder“ und die klaren Bilder der Sinne (Sehen, Hören, Fühlen) verstärken die emotionale Wirkung. Die Wiederbegegnung wird zu einem Spiegel der eigenen Veränderung und des Verlusts, der das lyrische Ich in Traurigkeit und Enttäuschung zurücklässt. Das Gedicht ist ein ergreifendes Zeugnis menschlicher Erfahrung, die davon handelt, wie die Zeit und die Ereignisse das Leben verändern und die Fähigkeit, Glück zu empfinden, beeinträchtigen können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.