Fahr wohl, du alte Schraube!
Mir warst du sehr egal.
Mir schmeckt die Lebenstraube,
Und dir ist alles Qual!
Tu immer, was du wolltest;
Ich stör dich nicht dabei.
Ich weiß nicht, was du solltest;
Ich laß dich gerne frei.
Und wenn du wieder grolltest,
So wär′s mir einerlei.
Schrei nur, mein Liebchen, schrei!
Abschiedslied
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
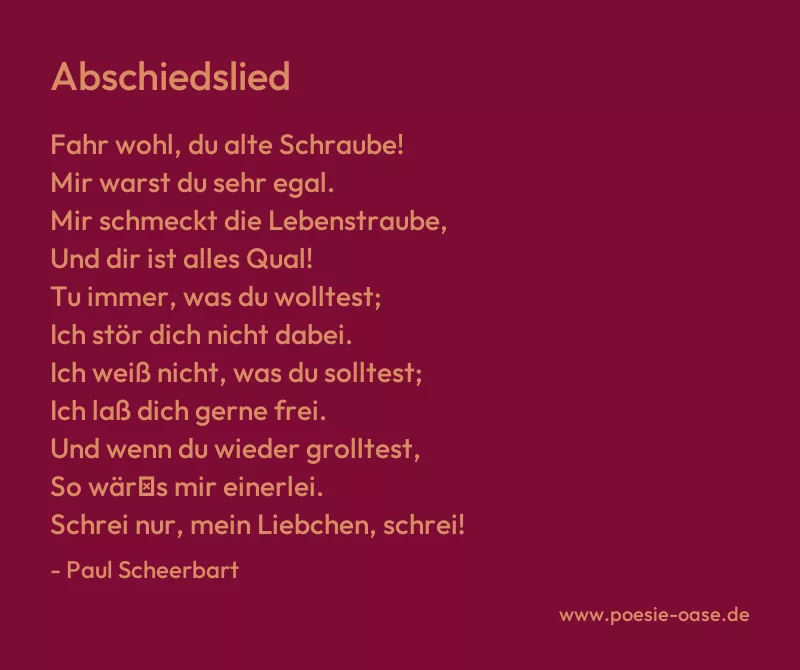
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abschiedslied“ von Paul Scheerbart ist eine augenzwinkernde und distanzierte Abschiedserklärung, die den Abschied von etwas oder jemandem feiert, das dem Sprecher gleichgültig geworden ist. Die Verwendung des Wortes „Schraube“ in der ersten Zeile ist ein ungewöhnliches, fast groteskes Bild, das die Beziehung zu einem Ding oder einer Person verdinglicht und entwertet, da es emotionslos und austauschbar wirkt. Der Abschied wird nicht mit Trauer oder Wehmut verbunden, sondern mit einer betonten Gleichgültigkeit, die den Ton des Gedichts bestimmt.
Die Metapher der „Lebenstraube“ im dritten Vers steht im krassen Gegensatz zur „alten Schraube“ und symbolisiert die Lebendigkeit, das Genießen und die Freude am Leben, die der Sprecher für sich beansprucht. Implizit wird hier eine Gegenüberstellung von Leben und Tod, oder zumindest von Vitalität und Stillstand, vorgenommen. Die „Schraube“ wird als Qual dargestellt, während der Sprecher die „Lebenstraube“ genießt. Das Gedicht bedient sich einfacher Reimschemata und einer direkten Sprache, was die Absicht des Dichters unterstreicht, eine klare und unmissverständliche Aussage zu treffen.
Der zweite Teil des Gedichts, beginnend mit „Tu immer, was du wolltest“, verstärkt die Distanzierung. Der Sprecher gewährt dem Gegenüber vollständige Freiheit, was die Gleichgültigkeit noch deutlicher macht. Die Sätze sind kurz und prägnant, was die Abneigung und die emotionale Loslösung des Sprechers unterstreicht. Das „Liebchen“ im letzten Vers, verbunden mit dem Aufruf zum Schreien, wirkt sarkastisch und zynisch. Es ist ein Ausdruck von Abneigung und eine bewusste Provokation, da die Reaktion des Anderen, sein Grollen oder Schreien, dem Sprecher „einerlei“ ist.
Scheerbart verwendet hier eine ironische und humorvolle Form, um über die Unfähigkeit zur Verbundenheit und die Gleichgültigkeit gegenüber anderen auszudrücken. Die „Schraube“ ist nicht nur ein Objekt, sondern steht für etwas, das den Sprecher belastet oder ihm nicht länger wichtig ist. Die scheinbar einfache Struktur des Gedichts verbirgt eine tiefere Auseinandersetzung mit den Themen Loslösung, Freiheit und dem Genuss des eigenen Lebens. Das Gedicht ist ein Beispiel für Scheerbarts spielerischen Umgang mit Sprache und seinen Blick auf die Absurditäten des menschlichen Daseins.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
