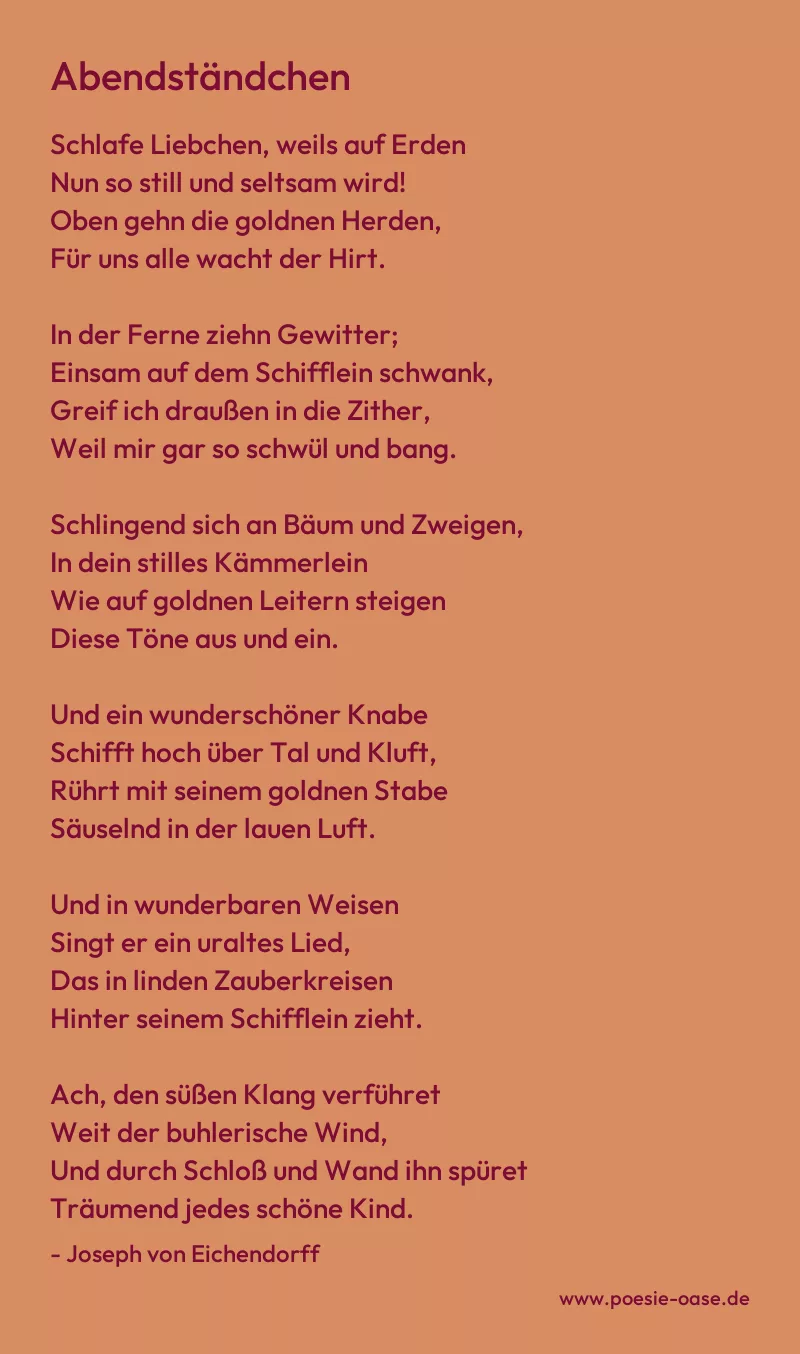Abendständchen
Schlafe Liebchen, weils auf Erden
Nun so still und seltsam wird!
Oben gehn die goldnen Herden,
Für uns alle wacht der Hirt.
In der Ferne ziehn Gewitter;
Einsam auf dem Schifflein schwank,
Greif ich draußen in die Zither,
Weil mir gar so schwül und bang.
Schlingend sich an Bäum und Zweigen,
In dein stilles Kämmerlein
Wie auf goldnen Leitern steigen
Diese Töne aus und ein.
Und ein wunderschöner Knabe
Schifft hoch über Tal und Kluft,
Rührt mit seinem goldnen Stabe
Säuselnd in der lauen Luft.
Und in wunderbaren Weisen
Singt er ein uraltes Lied,
Das in linden Zauberkreisen
Hinter seinem Schifflein zieht.
Ach, den süßen Klang verführet
Weit der buhlerische Wind,
Und durch Schloß und Wand ihn spüret
Träumend jedes schöne Kind.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
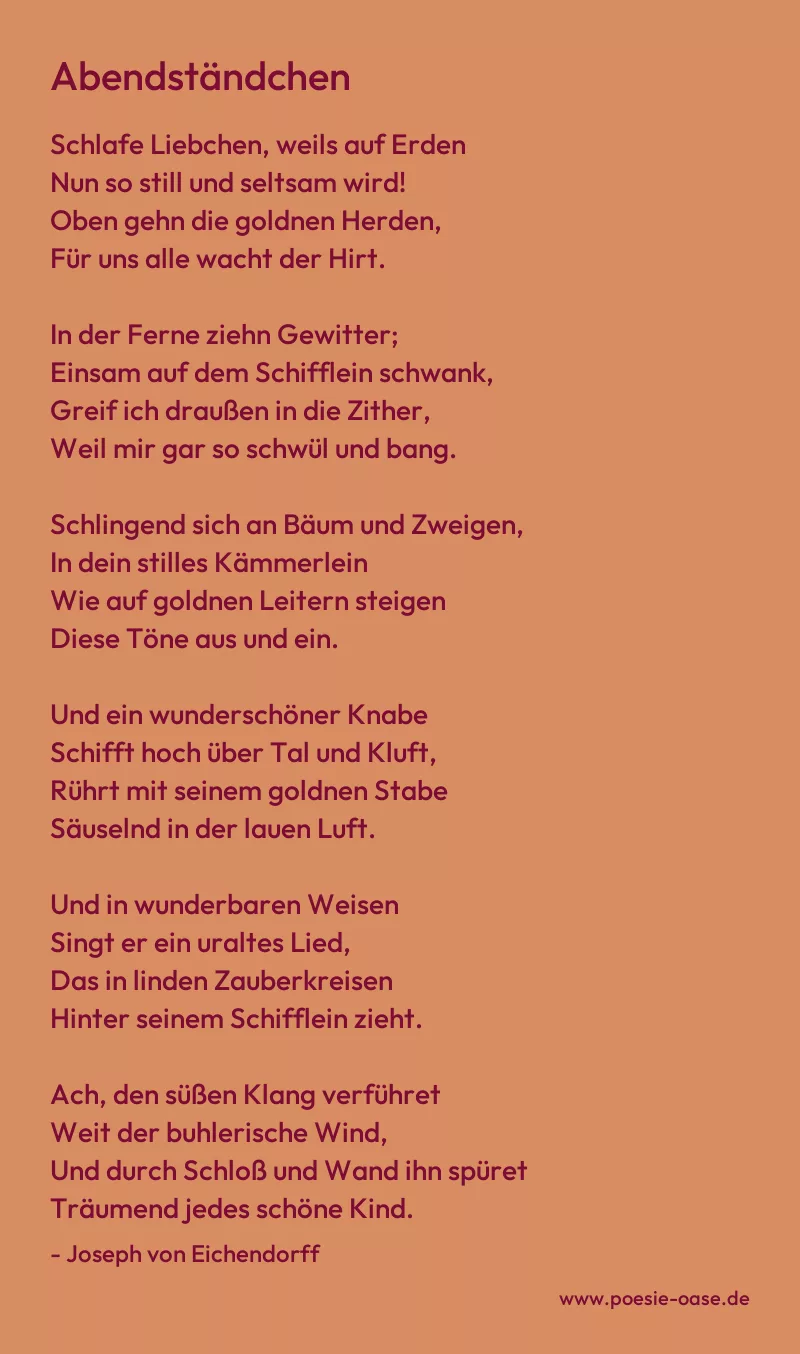
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abendständchen“ von Joseph von Eichendorff ist eine romantische Vertonung der Sehnsucht, der Stille und der Idylle, die in der Abenddämmerung liegt. Das Gedicht transportiert eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit, gemischt mit einer subtilen Ahnung von Unruhe und dem Verlangen nach etwas Unbekanntem. Der erste Vers etabliert eine Szenerie der Abendstille und suggeriert Geborgenheit: „Schlafe Liebchen, weils auf Erden / Nun so still und seltsam wird!“.
Das Gedicht verwendet eine Vielzahl von Bildern, um diese Atmosphäre zu erzeugen. Die „goldnen Herden“, die „oben“ ziehen, und der „Hirt“, der für alle wacht, suggerieren einen göttlichen Schutz und eine himmlische Ruhe. Der zweite Vers „In der Ferne ziehn Gewitter; / Einsam auf dem Schifflein schwank, / Greif ich draußen in die Zither, / Weil mir gar so schwül und bang.“ lässt die Idylle etwas brüchig werden, indem er die Ferne und die Angst vor dem Unbekannten thematisiert. Das „Schwanken“ auf dem „Schifflein“ und die „schwüle“ Bangigkeit deuten auf eine innere Unruhe hin, die durch die Musik, das „Zitherspiel“ des Dichters, ausgedrückt wird.
Die folgenden Strophen beschreiben die Übertragung dieser Musik in das Reich der Träume und der Schönheit. Die Töne steigen „wie auf goldnen Leitern“ ins „stille Kämmerlein“ auf, wo sie die Geliebte erreichen. Ein „wunder schöner Knabe“ symbolisiert die Macht der Kunst und der Poesie, die durch seine „goldnen Stabe“ in der „lauen Luft“ sanft säuselt und ein „uraltes Lied“ singt, das „in linden Zauberkreisen“ hinter seinem Schifflein herzieht. Diese Bilder evozieren eine Welt des Märchenhaften und der Transzendenz.
Die abschließenden Verse verstärken die Vorstellung der Verbreitung des Liedes und seiner Fähigkeit, Herzen zu berühren. Der „buhlerische Wind“ verführt den „süßen Klang“ weit und lässt ihn in Schlössern und durch Wände dringen, so dass „jedes schöne Kind“ träumend davon erfasst wird. Hier wird die allumfassende Kraft der Kunst und der romantischen Sehnsucht betont, die imstande ist, Menschen zu verbinden und eine Welt der Schönheit und des Traums zu schaffen. Das Gedicht ist somit ein Loblied auf die romantische Liebe, die Natur und die Macht der Poesie.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.