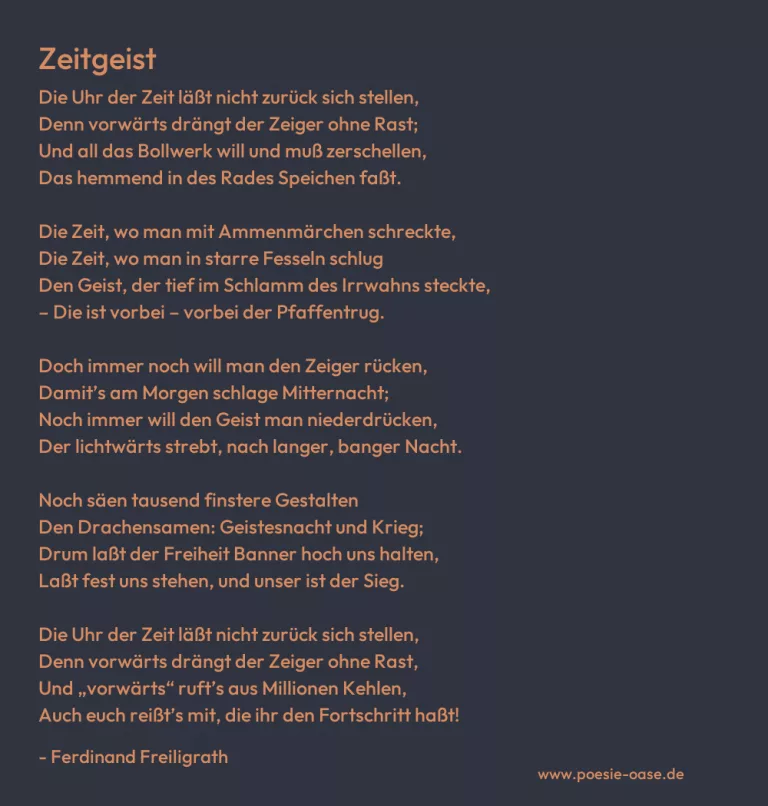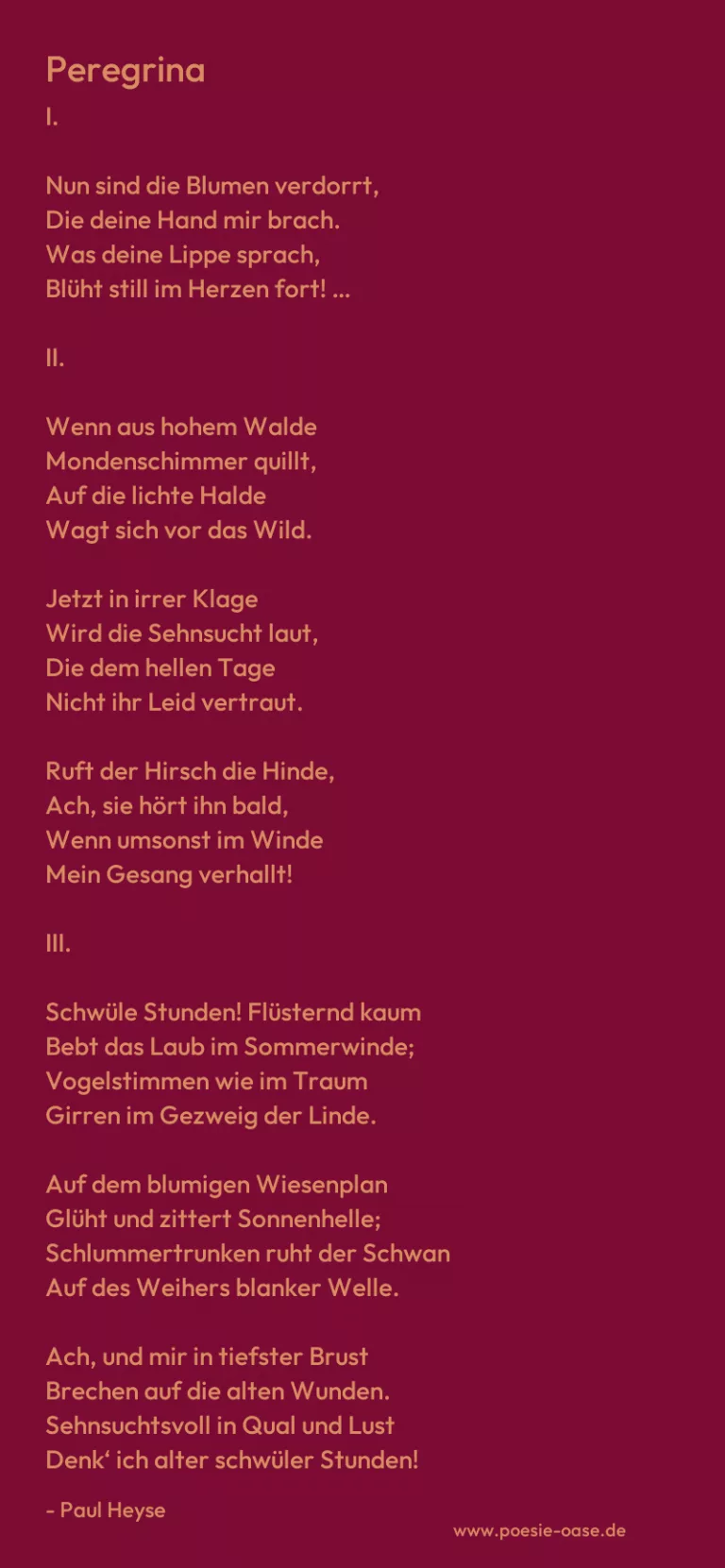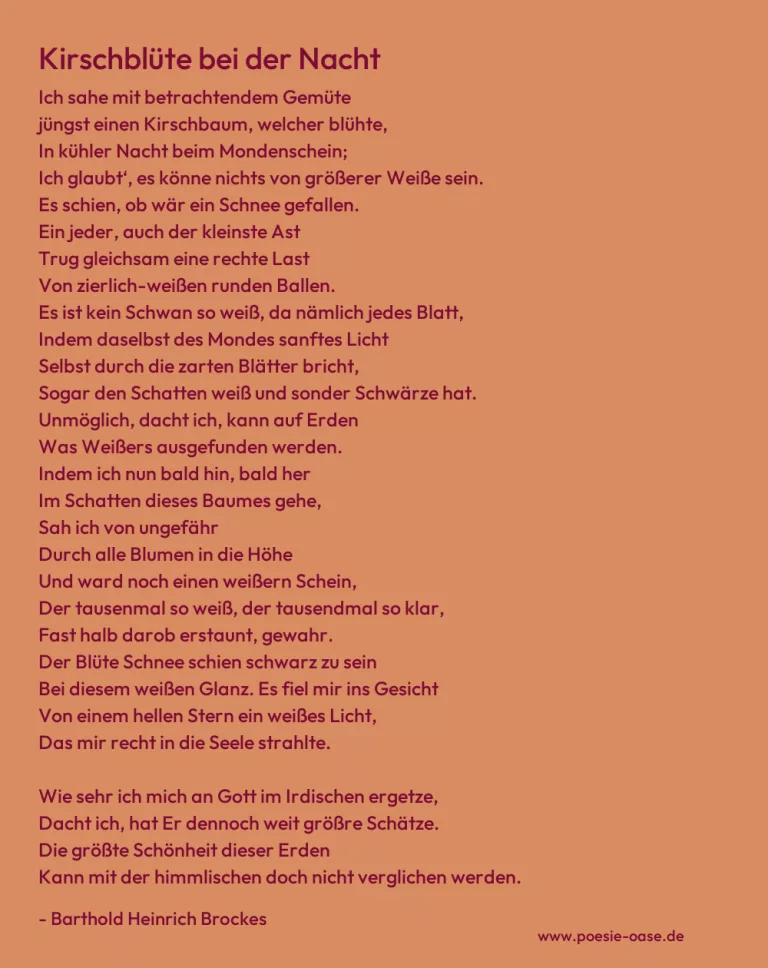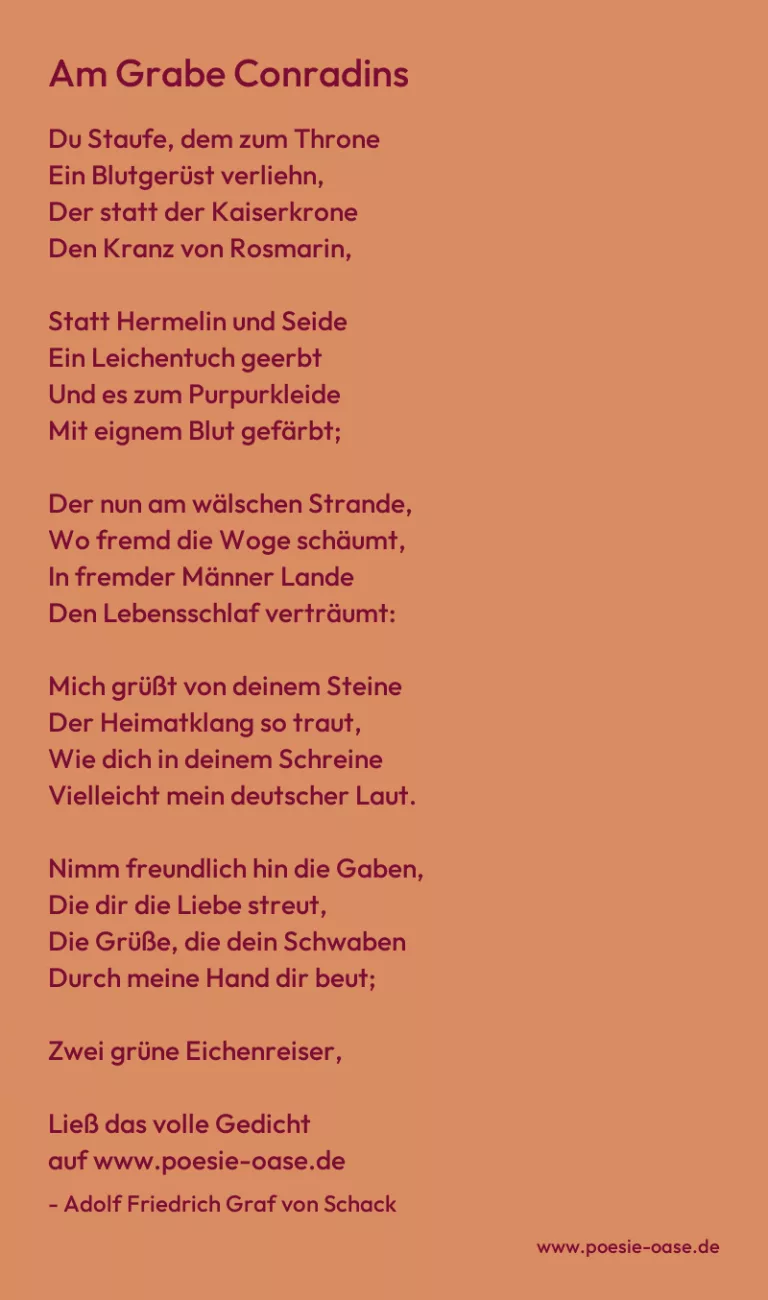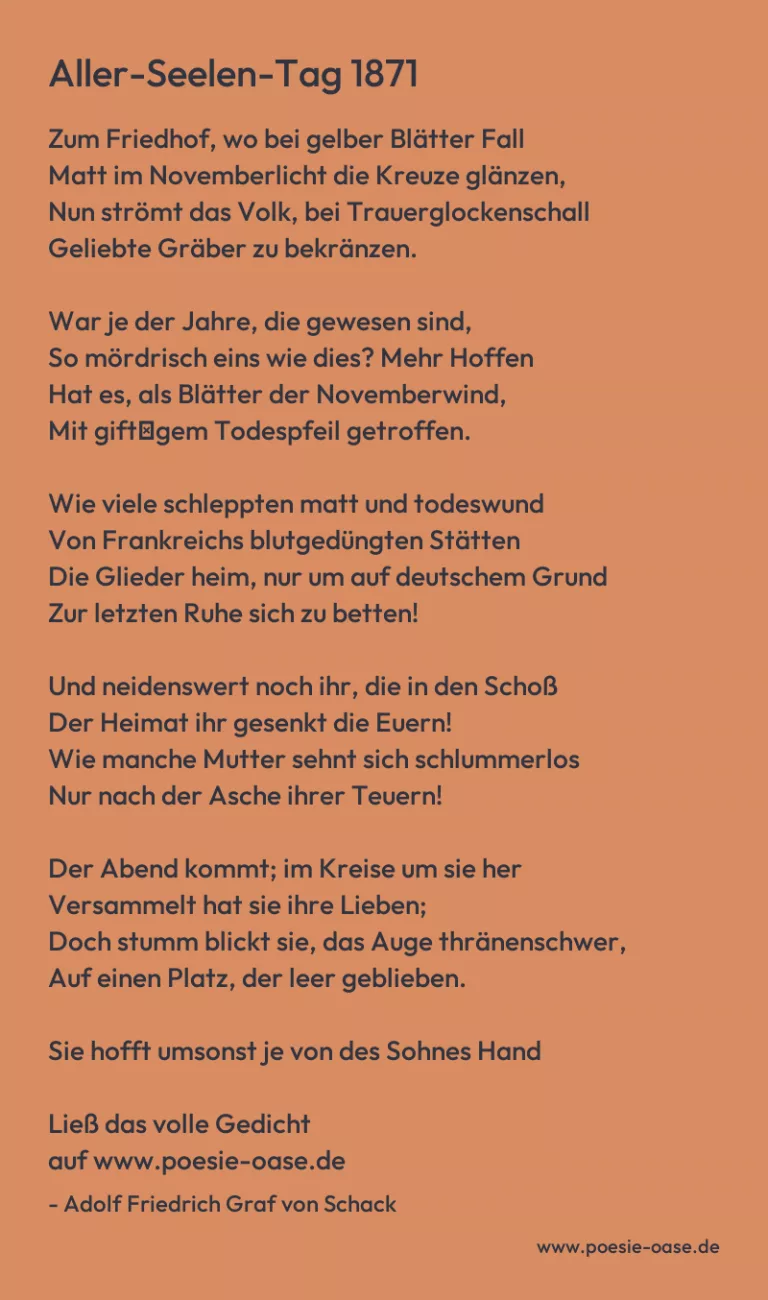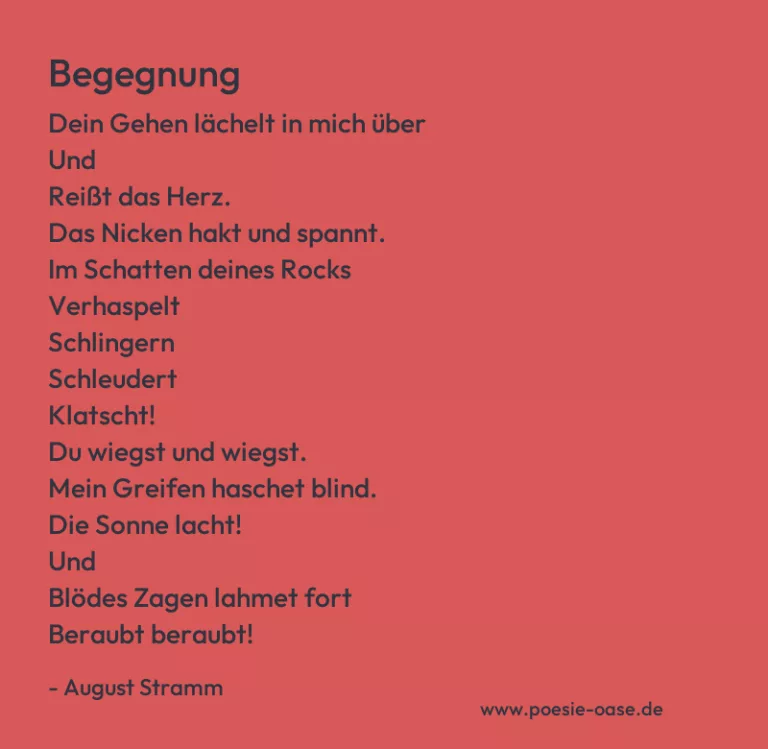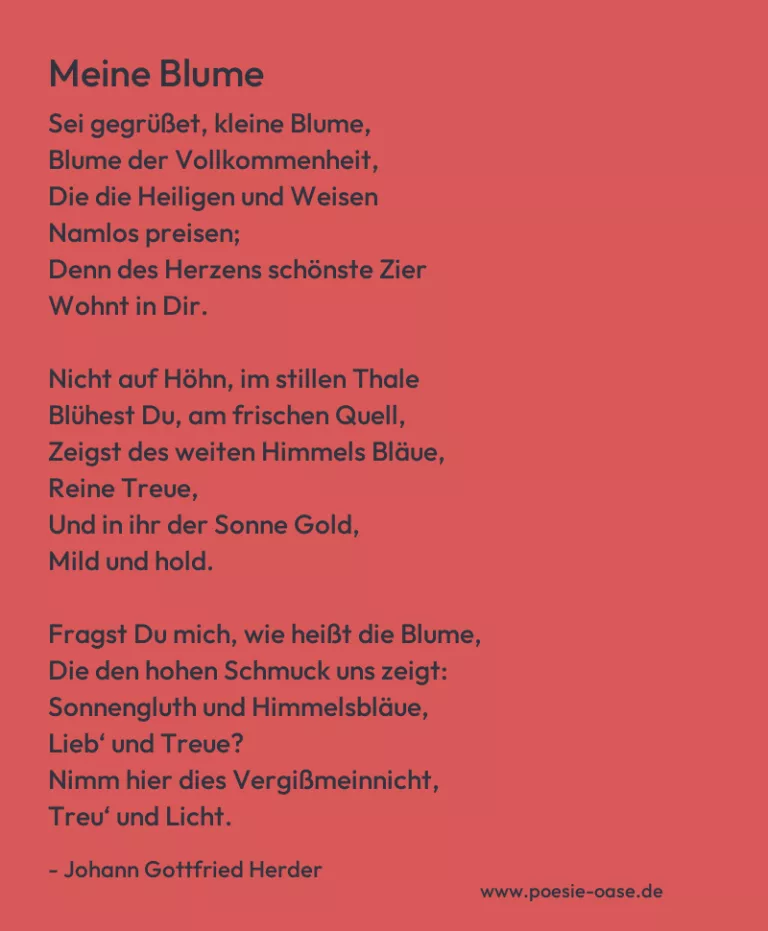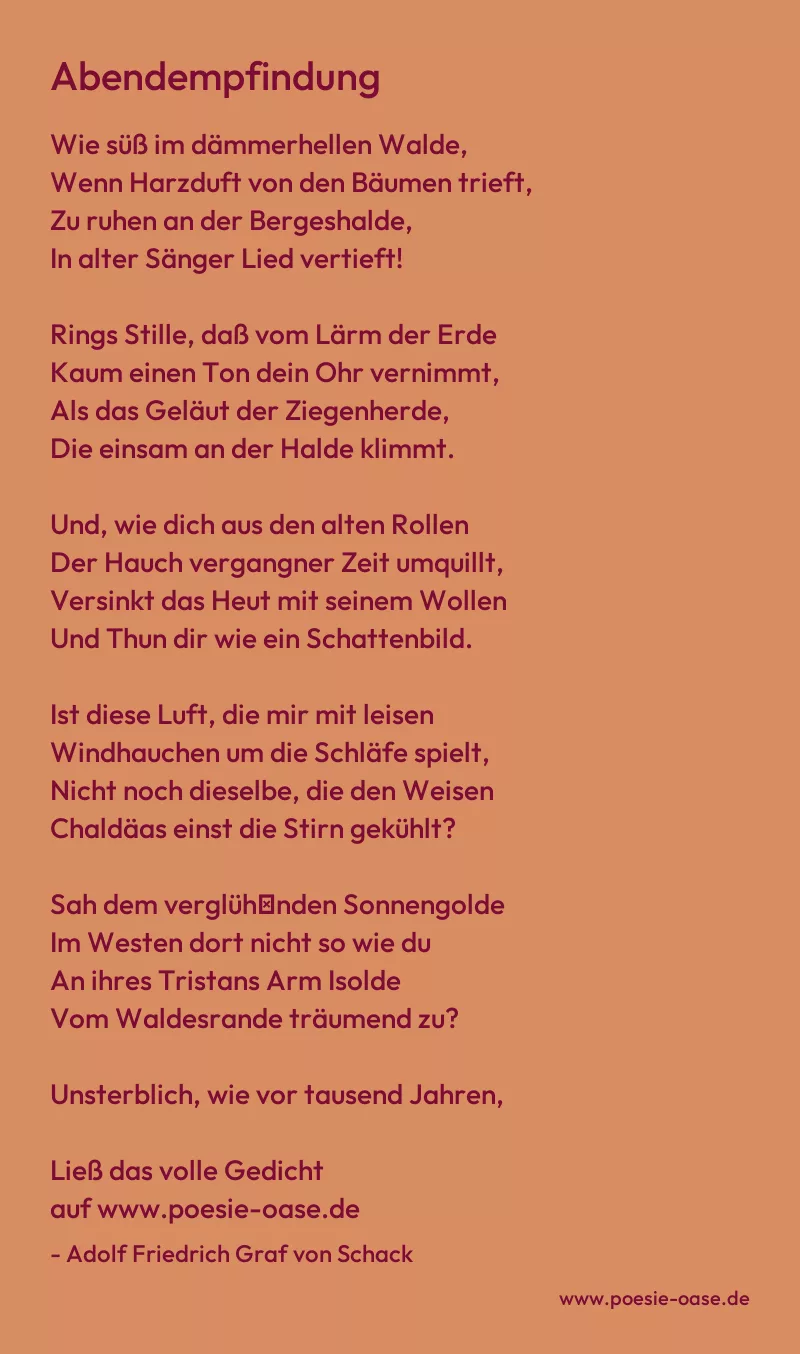Wie süß im dämmerhellen Walde,
Wenn Harzduft von den Bäumen trieft,
Zu ruhen an der Bergeshalde,
In alter Sänger Lied vertieft!
Rings Stille, daß vom Lärm der Erde
Kaum einen Ton dein Ohr vernimmt,
Als das Geläut der Ziegenherde,
Die einsam an der Halde klimmt.
Und, wie dich aus den alten Rollen
Der Hauch vergangner Zeit umquillt,
Versinkt das Heut mit seinem Wollen
Und Thun dir wie ein Schattenbild.
Ist diese Luft, die mir mit leisen
Windhauchen um die Schläfe spielt,
Nicht noch dieselbe, die den Weisen
Chaldäas einst die Stirn gekühlt?
Sah dem verglüh′nden Sonnengolde
Im Westen dort nicht so wie du
An ihres Tristans Arm Isolde
Vom Waldesrande träumend zu?
Unsterblich, wie vor tausend Jahren,
Blühn noch die Fluren, grünt das Laub,
Und die Geschlechter, welche waren,
Sie wären Asche nur und Staub?
Nein! in dem Werden und Entfalten
Zieht immer das Gewes′ne nur
Durch alle Formen und Gestalten
Der rastlos kreisenden Natur.
Nicht anders lebst du selbst als jene,
Die vor Jahrtausenden gelebt;
Alt, wie die Erde, ist die Thräne,
Die eben dir am Auge bebt.
Du denkst es; schon am Waldessaume
Erlosch die Glut des Abendscheins;
Es dunkelt, und du wirst im Traume,
Mit allen, die gewesen, eins.