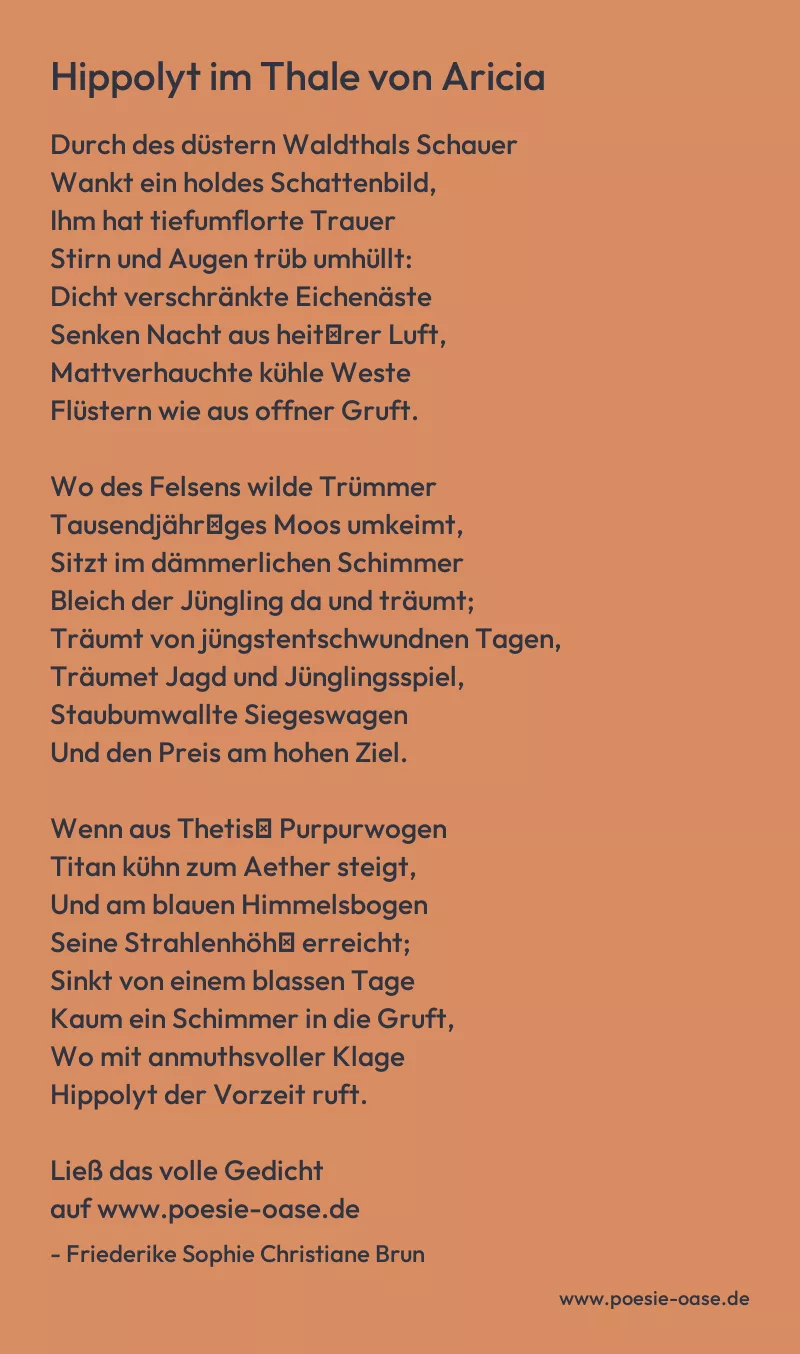Durch des düstern Waldthals Schauer
Wankt ein holdes Schattenbild,
Ihm hat tiefumflorte Trauer
Stirn und Augen trüb umhüllt:
Dicht verschränkte Eichenäste
Senken Nacht aus heit′rer Luft,
Mattverhauchte kühle Weste
Flüstern wie aus offner Gruft.
Wo des Felsens wilde Trümmer
Tausendjähr′ges Moos umkeimt,
Sitzt im dämmerlichen Schimmer
Bleich der Jüngling da und träumt;
Träumt von jüngstentschwundnen Tagen,
Träumet Jagd und Jünglingsspiel,
Staubumwallte Siegeswagen
Und den Preis am hohen Ziel.
Wenn aus Thetis′ Purpurwogen
Titan kühn zum Aether steigt,
Und am blauen Himmelsbogen
Seine Strahlenhöh′ erreicht;
Sinkt von einem blassen Tage
Kaum ein Schimmer in die Gruft,
Wo mit anmuthsvoller Klage
Hippolyt der Vorzeit ruft.
Ha! er rufet den Genossen:
»Auf zum Wettkampf, auf zum Streit!
Eilt herbei mit Flammenrossen,
Öffnet weit die Rennbahn, weit!
Von Trözenä′s engem Strande
Zum umwogten Isthmos hin,
Wo im heitern Sonnenlande
Meine Siegespalmen blühn!«
Ihm verstummt die Felsenhöhle,
Es verstummt der Waldgesang
Und die heiligtiefe Seele
Rasch ein Pfeil des Weh′s durchdrang!
Nur das leise Bächlein trauert
In sein tiefes Seelenweh,
Und von Wehmuth trüb umschauert
Kömmt′s herab von grüner Höh′!
»Bin ich noch? im Schattenlande,
Leb′ ich in der Oberwelt?
Wer, entführt dem Heimathsstrande,
Hat dem Nichts mich zugesellt?
Schatten dicht an Schatten wallen
Still in Plutos finster′m Land;
Doch in diese Felsenhallen
Bin ich einsam hingebannt!
»Harter Vater! deinem Zorne,
Folgt ihm nicht der herbe Tod?
War aus meines Lebens Borne
Nicht Trözens Gestade roth?
Göttin mit dem Silberbogen,
Nahmst du mich in deinen Schooß,
Als dem Scheusal aus den Wogen
Reines Blut der Unschuld floß?«
So erscheint in wirren Träumen
Ihm des ersten Lebens Bild;
Wie aus duftumflorten Räumen
Nachtgebilde trüb′ umhüllt;
»Göttin! – gabst du mir das Leben,
Gieb mir auch des Lebens Glück!
Laß mich leicht als Schatten schweben,
Oder sende mich zurück!«
Und ein weißes Reh erscheinet
In dem dichtverwachs′nen Wald,
Naht dem Jüngling und vereinet
Sich ihm zur Gespielin bald.
Streifet rasch an ihm vorüber,
Hüpft auf Felsen vor ihm hin;
Und je länger und je lieber
Wird′s des Jünglings trübem Sinn.
Endlich ruht′s an einer Quelle,
Die durch Felsen niederrollt;
In der reinergoss′nen Welle
Schwimmt des fernen Aethers Gold;
Myrt′ und Lorbeerwipfel neigen
Flüsternd sich darüber hin,
Und aus duft′gen Blüthenzweigen
Säuseln Schlummerphantasie′n
Schmachtend sinkt der Jüngling nieder
An bemoos′ter Felsenwand;
Sanft entstrickt die schönen Glieder
Ihm des Schlummers leise Hand,
Laue Abendwinde wanken
Durch das mildumglänzte Grün,
Und mit traubenvollen Ranken
Schirmt des Felsens Epheu ihn.
Düfte wallen, Blumen sprießen;
Schnee und Gold und Purpurglanz,
Ton′ und Farb′ und Duft umschließen
Ihn mit einem Wonnekranz!
Friedlich auf- und abgehoben
Wallt entfesselt seine Brust,
Und im Schlummer leis′ umwoben
Hat der Traumgott ihn mit Lust.
Um die schroffen Felsengipfel
Schwebt des Abends Purpurschein,
Durch der Ulmen luft′ge Wipfel
Tröpfelt Sonnengold herein:
Aus der tiefen Felsengrotte
Blickst du fern in′s Meeresblau,
Und dem heitern Sonnengotte
Folgt die Nacht mit Schlummerthau.
An der hohen Aetherhalle
Steigen still emporgelenkt
Nach und nach die Sternlein alle,
Sanft die Augen abgesenkt,
Wo vom süßen Schlaf umfangen
Hold der traute Schläfer liegt,
Und die hochentglühten Wangen
Leis′ ein Ahndungstraum umfliegt.
Alle sind vorbeigezogen;
Luna nur aus hoher Luft
Blickt vom blauen Himmelsbogen
Auf Aricia′s Felsengruft;
Rührt mit reinen Silberpfeilen
Sanft des Jünglings Augenlid,
Und von süßem Weh zu heilen,
Ach! erwachet Hippolyt.
»Welcher Wohllaut, welch ein Schimmer
Welcher Stimme Himmelston!
Ist es Stern′, ist′s Mondgeflimmer?
Wohn′ ich bei den Göttern schon?
Silberbogen seh ich schweben
Nah und näher stets um mich,
Und ein niegefühltes Leben
Überströmt mit Sehnsucht mich.
Und in sanft′re Schatten tauchet
Sich der Glanz, das Silberlicht;
Süß′rer Liebeston umhauchet
Philomela′s Wiege nicht!
Und der Bach ist Lied geworden,
Alle Wipfel Melodie!
Und von süßeren Accorden
Hallte Sappho′s Leier nie!
»Sind Elysium diese Thale?
Bist du Lethe, holder Bach?
Trank aus des Vergessens Schale
Ich mich süß vom Schlummer wach?
Welch ein Licht um meine Seele,
Welch ein Frieden in der Brust!
Aus der finstern Schmerzenshöhle
Stieg ich auf zu Götterlust.
»Ward ich sanft empor gehoben,
Ach, in reine Göttergluth!
Und von Wonneglanz umwoben
Taucht′ ich in die heil′ge Fluth;
Im Olymp, im Schattenlande,
Bei des Schicksals finster′m Blick,
In des trübsten Daseyns Stande,
Überall ist Liebe Glück!«
Glanz und Ton sind hingeschwunden,
Doch des Busens inn′res Licht,
Dieser Traum von Götterstunden
Schwindet ewig, ewig nicht!
Wer im reinen Herzen fühlet
Heil′ger Liebe Himmelslust,
Keine Erdenquelle kühlet
Ihm die Flamm′ in hoher Brust!