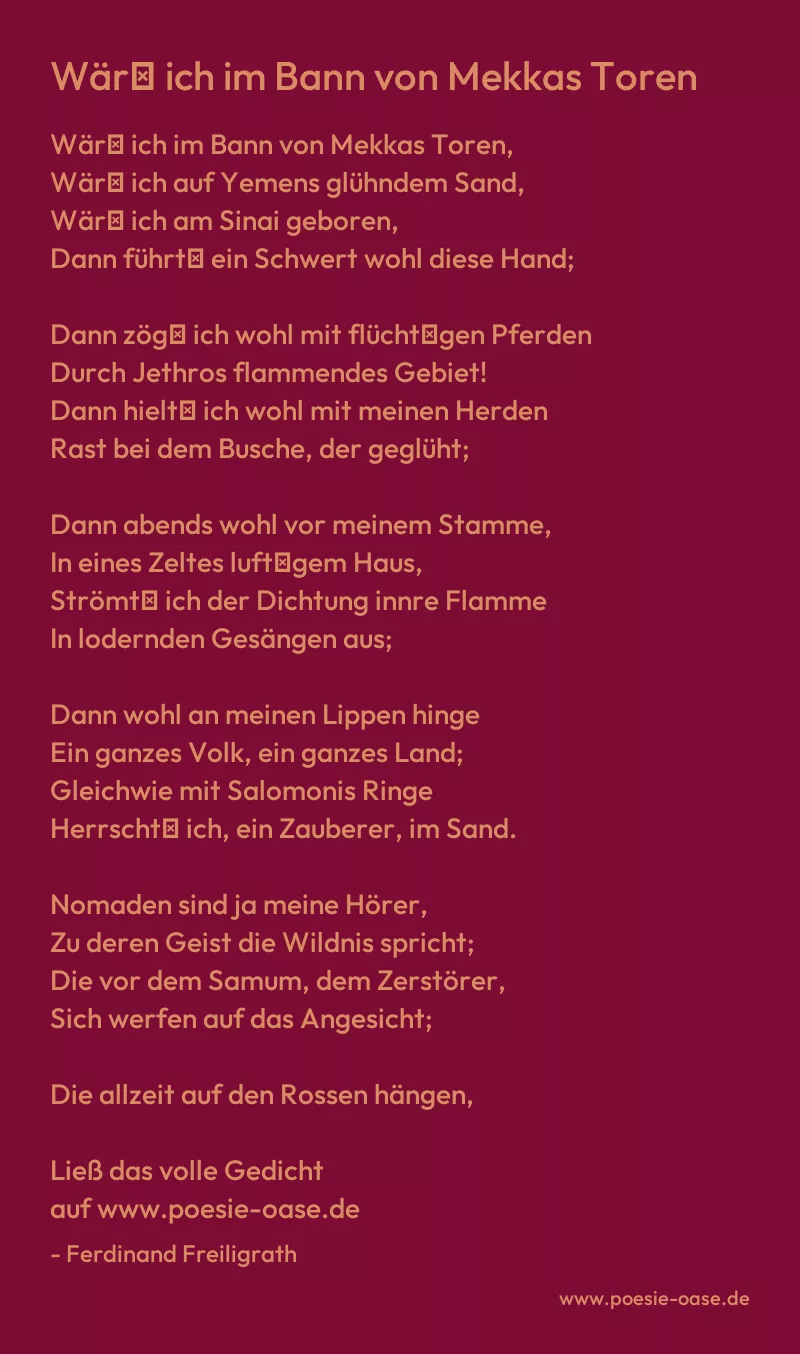Wär′ ich im Bann von Mekkas Toren,
Wär′ ich auf Yemens glühndem Sand,
Wär′ ich am Sinai geboren,
Dann führt′ ein Schwert wohl diese Hand;
Dann zög′ ich wohl mit flücht′gen Pferden
Durch Jethros flammendes Gebiet!
Dann hielt′ ich wohl mit meinen Herden
Rast bei dem Busche, der geglüht;
Dann abends wohl vor meinem Stamme,
In eines Zeltes luft′gem Haus,
Strömt′ ich der Dichtung innre Flamme
In lodernden Gesängen aus;
Dann wohl an meinen Lippen hinge
Ein ganzes Volk, ein ganzes Land;
Gleichwie mit Salomonis Ringe
Herrscht′ ich, ein Zauberer, im Sand.
Nomaden sind ja meine Hörer,
Zu deren Geist die Wildnis spricht;
Die vor dem Samum, dem Zerstörer,
Sich werfen auf das Angesicht;
Die allzeit auf den Rossen hängen,
Absitzend nur am Wüstenbronn;
Die mit verhängten Zügeln sprengen
Von Aden bis zum Libanon;
Die nachts, als nimmermüde Späher,
Bei ihrem Vieh ruhn auf der Trift,
Und, wie vorzeiten die Chaldäer,
Anschaun des Himmels goldne Schrift;
Die oft ein Murmeln noch vernehmen
Von Sina′s glutgeborstnen Höhn,
Die oft des Wüstengeistes Schemen
In Säulen Rauches wandeln sehn;
Die durch den Riß oft des Gesteines
Erschaun das Flammen seiner Stirn –
Ha, Männer, denen glühnd wie meines
In heißen Schädeln brennt das Hirn.
O Land der Zelte, der Geschosse!
O Volk der Wüste, kühn und schlicht!
Beduin, du selbst auf deinem Rosse
Bist ein phantastisches Gedicht! –
Ich irr auf mitternächt′ger Küste;
Der Norden, ach, ist kalt und klug.
Ich wollt′, ich säng′ im Sand der Wüste,
Gelehnt an eines Hengstes Bug.