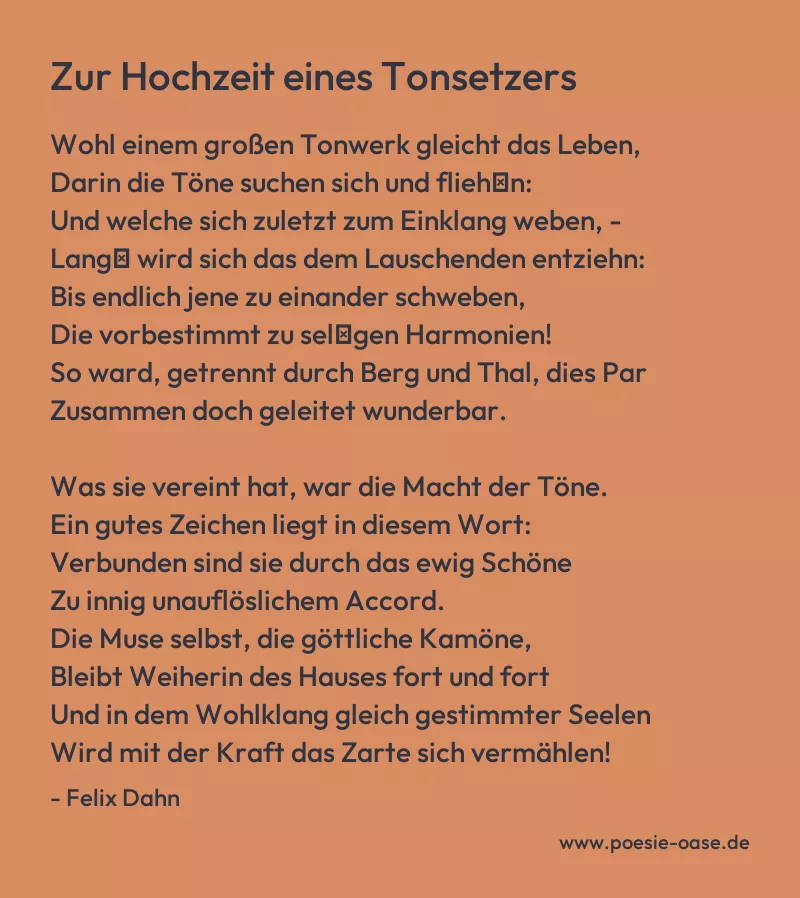Zur Hochzeit eines Tonsetzers
Wohl einem großen Tonwerk gleicht das Leben,
Darin die Töne suchen sich und flieh′n:
Und welche sich zuletzt zum Einklang weben, –
Lang′ wird sich das dem Lauschenden entziehn:
Bis endlich jene zu einander schweben,
Die vorbestimmt zu sel′gen Harmonien!
So ward, getrennt durch Berg und Thal, dies Par
Zusammen doch geleitet wunderbar.
Was sie vereint hat, war die Macht der Töne.
Ein gutes Zeichen liegt in diesem Wort:
Verbunden sind sie durch das ewig Schöne
Zu innig unauflöslichem Accord.
Die Muse selbst, die göttliche Kamöne,
Bleibt Weiherin des Hauses fort und fort
Und in dem Wohlklang gleich gestimmter Seelen
Wird mit der Kraft das Zarte sich vermählen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
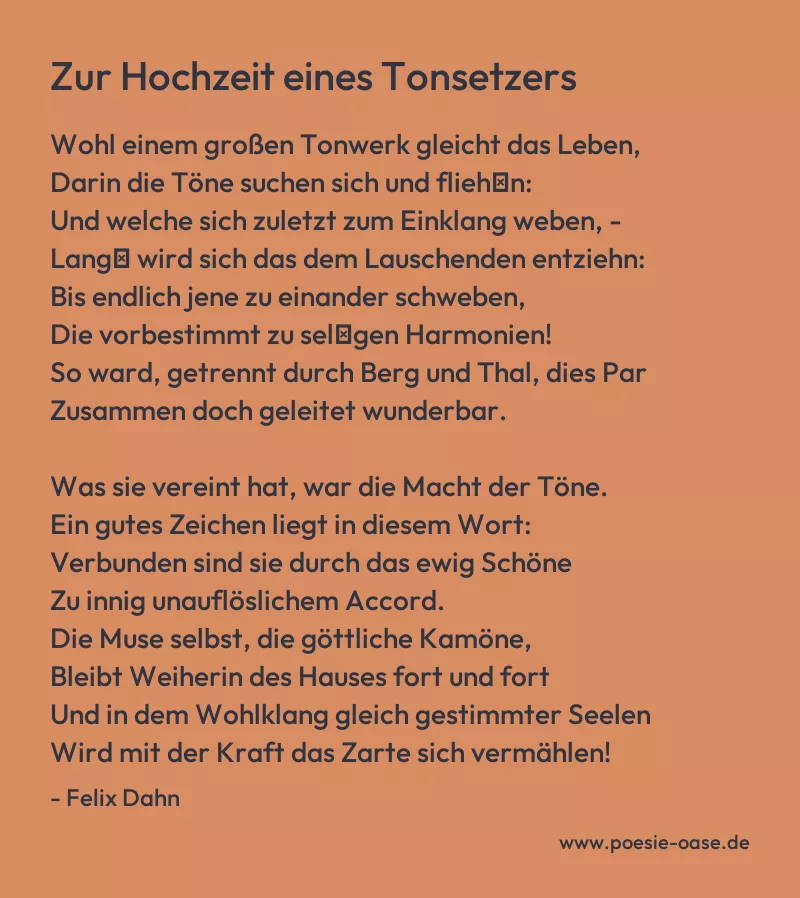
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zur Hochzeit eines Tonsetzers“ von Felix Dahn ist eine Huldigung an die Ehe, dargestellt durch die Metapher der Musik. Es feiert das Zusammenfinden zweier Menschen, die wie musikalische Töne im Leben aufeinander zugesteuert sind, um eine harmonische Einheit zu bilden. Der Titel, der sich auf einen „Tonsetzer“ bezieht, deutet darauf hin, dass das Gedicht nicht nur eine Liebeserklärung, sondern auch eine Reflexion über die Kunst des Komponierens und das Schaffen von Harmonie ist. Die Verwendung von musikalischen Begriffen wie „Einklang“, „Harmonien“ und „Akkord“ verstärkt diese Analogie und verbindet die Welt der Musik mit der Welt der Liebe und Ehe.
Der erste Teil des Gedichts (Strophe 1) beschreibt das Leben als ein „großes Tonwerk“, in dem die Töne (Menschen) sich suchen und entfliehen. Erst wenn diese Töne „zusammen schweben“, entsteht ein „Einklang“. Dies unterstreicht die Idee, dass wahre Liebe und Ehe das Ergebnis eines langen Prozesses des Suchens, Findens und schließlich des Zusammenkommens sind. Der Dichter betont die „sel’gen Harmonien“, die durch diese Verbindung entstehen, und weist darauf hin, dass die Vereinigung des Paares eine wunderbare Fügung ist, die durch „Berg und Thal“ (Hindernisse) geleitet wurde.
In der zweiten Strophe wird der Fokus auf das, was die beiden vereint, gelegt: die „Macht der Töne“ und das „ewig Schöne“. Dies deutet auf die Bedeutung von Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise die Liebe zur Musik, und die Wertschätzung von Schönheit und Harmonie in der Beziehung hin. Die „Muse selbst, die göttliche Kamöne“, wird als Beschützerin und Zeugin dieser Verbindung bezeichnet, was die Heiligkeit und göttliche Qualität der Ehe hervorhebt. Der Vers „In dem Wohlklang gleich gestimmter Seelen / Wird mit der Kraft das Zarte sich vermählen!“ deutet auf das Gleichgewicht zwischen Stärke und Zärtlichkeit, das in einer harmonischen Beziehung existieren sollte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gedicht eine elegante Metapher für die Ehe darstellt, die durch die Kunst der Musik ausgedrückt wird. Es feiert das Zusammenfinden zweier Seelen, die durch die „Macht der Töne“ und das Streben nach Harmonie vereint sind. Die Verwendung musikalischer Begriffe, die Betonung des „Einklangs“ und der „Harmonien“ sowie die Anrufung der Muse als Beschützerin der Ehe unterstreichen die Idee, dass die Liebe und die Ehe eine Form der Kunst sind, die durch Hingabe, Ausdauer und das Streben nach Schönheit und Harmonie vollendet wird. Das Gedicht ist somit eine feierliche Ode an die Ehe und eine Hommage an die Kunst des Zusammenlebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.